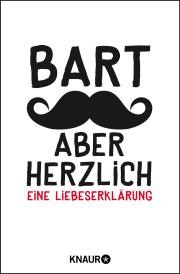 Es muss ja nicht immer Literatur sein. Oder?
Es muss ja nicht immer Literatur sein. Oder?
Während sich der deutsche Buchmarkt innerhalb der letzten Jahre immer mehr in eine Art Selbstfindungskrise stürzt, scheinen bisher nur zwei Resultate als klare Folgen erkenntlich zu werden: Zum einen die Unterscheidung zwischen E(rnster)- und U(nterhaltungs)-Literatur, zum anderen der kometenhafte Aufstieg der sogenannten »Coffee Table Books«. Ersteres sollte mit viel Vorsicht genossen werden und bietet immer wieder Raum (und Bedarf) für hitzige Diskussionen, letzteres hingegen ist weitaus harmloser, erfordert jedoch auf Grund der massenhaften Ausbreitung früher oder später ein Auseinandersetzen mit dem Thema. Weiterlesen

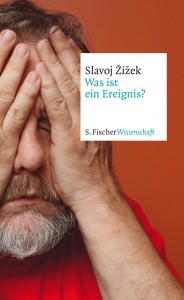 Slavoj Žižek, das enfant terrible der Philosophie, meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: „Was ist ein Ereignis?“ heißt das neue Buch, das in der Sachbuch-Abteilung des Fischer Verlags erscheint. Schon der Titel macht klar, dass es hier nicht um irgendwelche Haarspaltereien auf metaphysischer Ebene gehen soll, sondern um Grundsätzliches. Sollte der geneigte Leser sich bereits an dieser Stelle fragen: „Who the f*ck is Žižek?“, so findet er im Folgenden eine kleine Einführung:
Slavoj Žižek, das enfant terrible der Philosophie, meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: „Was ist ein Ereignis?“ heißt das neue Buch, das in der Sachbuch-Abteilung des Fischer Verlags erscheint. Schon der Titel macht klar, dass es hier nicht um irgendwelche Haarspaltereien auf metaphysischer Ebene gehen soll, sondern um Grundsätzliches. Sollte der geneigte Leser sich bereits an dieser Stelle fragen: „Who the f*ck is Žižek?“, so findet er im Folgenden eine kleine Einführung: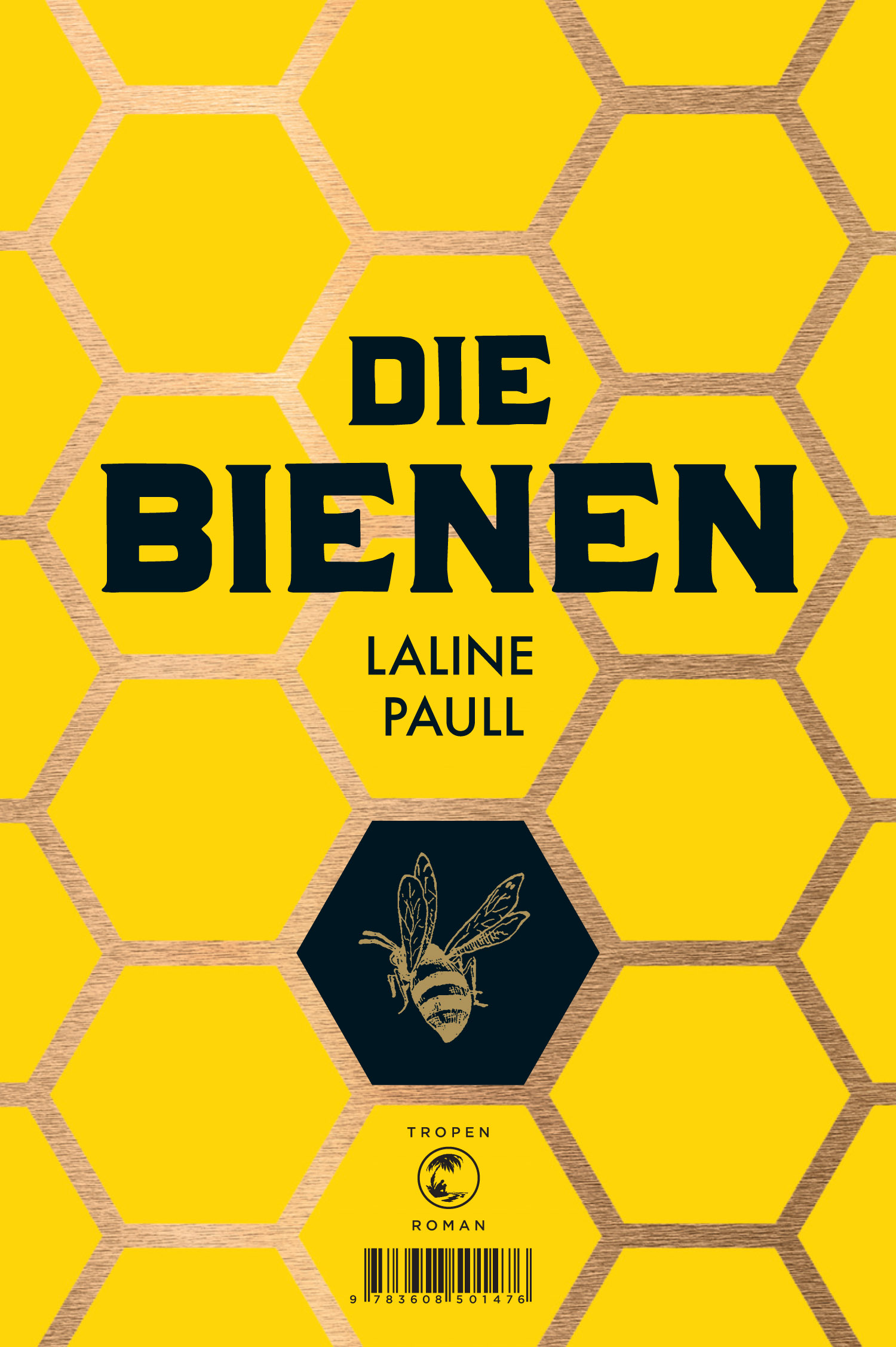
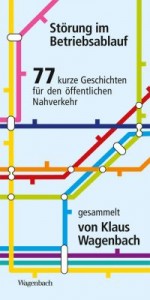 Es ist schon verhext: Hunderte Male steigt man in den Zug, fährt von A nach B, liest dazwischen ein gutes Buch und steigt wieder aus. Und dann liegt auf einmal alles lahm, Bahnhöfe erinnern an Flüchtlingslager in der dritten Welt und alle schimpfen, mit unterschiedlichen Sündenböcken, vor sich hin. Als wäre das alles vorauszusehen gewesen, erschien kurz vor der Buchmesse ein kleines, auf den ersten Blick unscheinbares Büchlein im Wagenbach-Verlag. „Störung im Betriebslauf“ steht in nüchternen, schwarzen Lettern auf dem himmelblauen Cover, das mehr an einen
Es ist schon verhext: Hunderte Male steigt man in den Zug, fährt von A nach B, liest dazwischen ein gutes Buch und steigt wieder aus. Und dann liegt auf einmal alles lahm, Bahnhöfe erinnern an Flüchtlingslager in der dritten Welt und alle schimpfen, mit unterschiedlichen Sündenböcken, vor sich hin. Als wäre das alles vorauszusehen gewesen, erschien kurz vor der Buchmesse ein kleines, auf den ersten Blick unscheinbares Büchlein im Wagenbach-Verlag. „Störung im Betriebslauf“ steht in nüchternen, schwarzen Lettern auf dem himmelblauen Cover, das mehr an einen 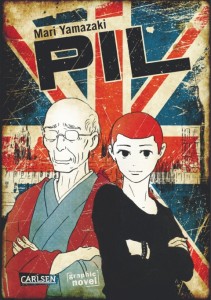 Er hat – obwohl millionenfach verkauft – eine schwierige Position im deutschen Buchmarkt, seine Thematik wird gleichermaßen extrem abgelehnt wie frenetisch verteidigt. Die Rede ist nicht etwa von Günther Grass, sondern vom Manga, eben jenem Genre, das seit ungefähr zwei Jahrzehnten auch in Deutschland einen kometenhaften Aufstieg erfuhr.
Er hat – obwohl millionenfach verkauft – eine schwierige Position im deutschen Buchmarkt, seine Thematik wird gleichermaßen extrem abgelehnt wie frenetisch verteidigt. Die Rede ist nicht etwa von Günther Grass, sondern vom Manga, eben jenem Genre, das seit ungefähr zwei Jahrzehnten auch in Deutschland einen kometenhaften Aufstieg erfuhr.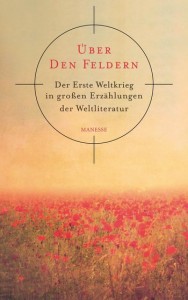
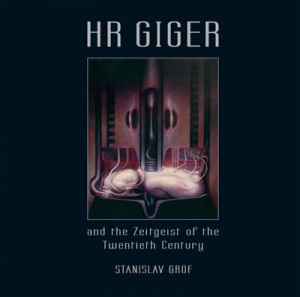 Am frühen Morgen taucht eine Nachrichtenmeldung auf,die ironischer nicht sein könnte.Hansruedi (HR) Giger, der Erfinder des »Aliens«, der Zeit seines Lebens Abneigung und Ängste gegenüber Treppen und ähnlichen Angelegenheiten hatte, erliegt den Folgen der Verletzungen, die er sich bei einem Sturz zugezogen hat.
Am frühen Morgen taucht eine Nachrichtenmeldung auf,die ironischer nicht sein könnte.Hansruedi (HR) Giger, der Erfinder des »Aliens«, der Zeit seines Lebens Abneigung und Ängste gegenüber Treppen und ähnlichen Angelegenheiten hatte, erliegt den Folgen der Verletzungen, die er sich bei einem Sturz zugezogen hat. 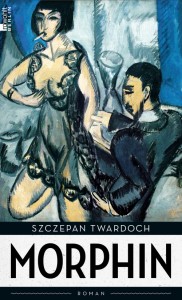 Um sämtliche Missverständnisse gleich zu Beginn aus dem Weg zu räumen: Das kürzlich im Rowohlt-Verlag erschienene »Morphin« ist keineswegs die Fortsetzung von M. Agejews »Roman mit Kokain«. Vielmehr handelt es sich bei Szczepan Twardoch um einen Autor der Gegenwart, der die Handlung seines Erstlings ins Warschau am Ende der 30er Jahre versetzt, der goldenen Ära des Morphins. Protagonist Konstanty Willemann, von seinen Freunden kurz Kostek geheißen, erwacht eines Morgens, verkatert und hungrig, die Deutschen haben Polen gerade überrannt und für einen Reserveoffizier wie Kostek gibt es kaum etwas zu tun. Also besucht er die Cafés, in denen die geschlagenen Generäle und Majore schon über den Befreiungskrieg fachsimpeln, sieht sich die jüdische Oberschicht an, die mit bereits gepackten Koffern versucht, letzte Wertgegenstände gegen Bares einzutauschen und wandert die Straßen des zerstörten, »vergewaltigten« Warschaus hinunter.
Um sämtliche Missverständnisse gleich zu Beginn aus dem Weg zu räumen: Das kürzlich im Rowohlt-Verlag erschienene »Morphin« ist keineswegs die Fortsetzung von M. Agejews »Roman mit Kokain«. Vielmehr handelt es sich bei Szczepan Twardoch um einen Autor der Gegenwart, der die Handlung seines Erstlings ins Warschau am Ende der 30er Jahre versetzt, der goldenen Ära des Morphins. Protagonist Konstanty Willemann, von seinen Freunden kurz Kostek geheißen, erwacht eines Morgens, verkatert und hungrig, die Deutschen haben Polen gerade überrannt und für einen Reserveoffizier wie Kostek gibt es kaum etwas zu tun. Also besucht er die Cafés, in denen die geschlagenen Generäle und Majore schon über den Befreiungskrieg fachsimpeln, sieht sich die jüdische Oberschicht an, die mit bereits gepackten Koffern versucht, letzte Wertgegenstände gegen Bares einzutauschen und wandert die Straßen des zerstörten, »vergewaltigten« Warschaus hinunter. 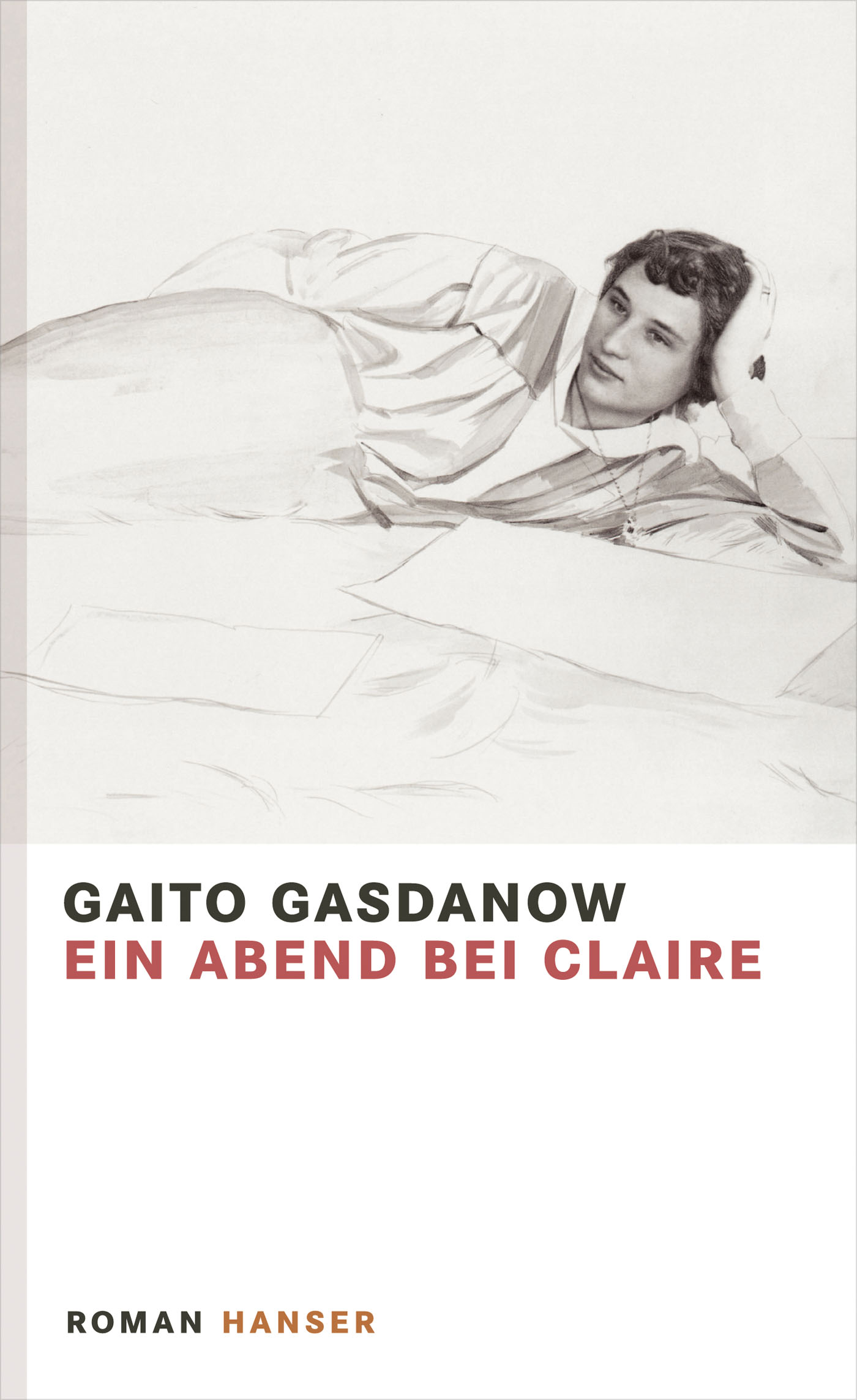 Er war neben M. Agejews „Roman mit Kokain“ wohl die fantastischste (Wieder-) Entdeckung des Jahres 2013: Sein im Hanser-Verlag erschienener, neu übersetzter Roman „Das Phantom des Alexander Wolf“ überzeugte Liebhaber wie Kritiker der russischen Exilliteratur gleichermaßen. Der Name Gaito Gasdanow ist insofern also Programm. Nun erscheint – ebenfalls bei Hanser – sein zweiter Streich, wobei es eigentlich vielmehr der erste ist, denn „Ein Abend bei Claire“ war das Erstlingswerk des stillen Russen. Zur Jahreswende 1929/30 veröffentliche der damals Sechsundzwanzigjährige jenes Werk, das ihn mit einem Schlag vom hungerleidenden Taxifahrer und Essaisten zum gefeierten Exilliteraten beförderte, der im selben Atemzug wie Vladimir Nabokov genannt werden sollte.
Er war neben M. Agejews „Roman mit Kokain“ wohl die fantastischste (Wieder-) Entdeckung des Jahres 2013: Sein im Hanser-Verlag erschienener, neu übersetzter Roman „Das Phantom des Alexander Wolf“ überzeugte Liebhaber wie Kritiker der russischen Exilliteratur gleichermaßen. Der Name Gaito Gasdanow ist insofern also Programm. Nun erscheint – ebenfalls bei Hanser – sein zweiter Streich, wobei es eigentlich vielmehr der erste ist, denn „Ein Abend bei Claire“ war das Erstlingswerk des stillen Russen. Zur Jahreswende 1929/30 veröffentliche der damals Sechsundzwanzigjährige jenes Werk, das ihn mit einem Schlag vom hungerleidenden Taxifahrer und Essaisten zum gefeierten Exilliteraten beförderte, der im selben Atemzug wie Vladimir Nabokov genannt werden sollte.  Welchen Geschmack hat Zynismus? Und welche Farbe besitzt Desillusionierung?
Welchen Geschmack hat Zynismus? Und welche Farbe besitzt Desillusionierung? Die Kurzgeschichte hat es nicht leicht in Deutschland. Vergangen sind die Tage der Gruppe 47, vorbei die Ära von E.T.A. Hoffmann bis Heinrich Böll. Vereinzelt schaffen es noch Bände mit Erzählungen in die öffentliche Aufmerksamkeit, beispielsweise »Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes« von Clemens J. Setz im Jahr 2011, aber ansonsten steht die traurige Tatsache seit einiger Zeit fest: Die Kurzgeschichte ist – neben der Lyrik – das schwierigste Terrain im deutschen Buchmarkt, vor allem für junge, unbekanntere Autoren.
Die Kurzgeschichte hat es nicht leicht in Deutschland. Vergangen sind die Tage der Gruppe 47, vorbei die Ära von E.T.A. Hoffmann bis Heinrich Böll. Vereinzelt schaffen es noch Bände mit Erzählungen in die öffentliche Aufmerksamkeit, beispielsweise »Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes« von Clemens J. Setz im Jahr 2011, aber ansonsten steht die traurige Tatsache seit einiger Zeit fest: Die Kurzgeschichte ist – neben der Lyrik – das schwierigste Terrain im deutschen Buchmarkt, vor allem für junge, unbekanntere Autoren.