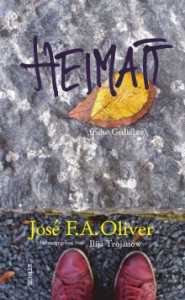 Man muss den Verlag Hans Schiler aus Berlin einfach bewundern. Nicht nur, dass es das kleine Team Jahr für Jahr schafft, ein Programm auf die Beine zu stellen, das es durchaus mit dem der „Großen“ aufnehmen kann. Die veröffentlichen Werke haben auch stets eine Qualität, die man sich bei manch anderem Verlag wünschen würde. Diese Qualität reicht von dem Niveau der Texte über die editorische Gestaltung bis hin zur Vermarktung – wobei letztere heutzutage gerade bei Independent-Verlagen vermutlich den entscheidendsten Faktor ausmacht, denn auch der beste Roman geht unter, wenn man ihn nirgendwo kaufen kann.
Man muss den Verlag Hans Schiler aus Berlin einfach bewundern. Nicht nur, dass es das kleine Team Jahr für Jahr schafft, ein Programm auf die Beine zu stellen, das es durchaus mit dem der „Großen“ aufnehmen kann. Die veröffentlichen Werke haben auch stets eine Qualität, die man sich bei manch anderem Verlag wünschen würde. Diese Qualität reicht von dem Niveau der Texte über die editorische Gestaltung bis hin zur Vermarktung – wobei letztere heutzutage gerade bei Independent-Verlagen vermutlich den entscheidendsten Faktor ausmacht, denn auch der beste Roman geht unter, wenn man ihn nirgendwo kaufen kann.
Schlagwort-Archive: Berlin
»Ich wollte ja nicht ein weiteres Buch über die RAF schreiben«
 Frank Witzel, Buchpreisträger und Autor des alle Rahmen sprengenden Romans »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969«, hat uns vor seiner Lesung im Frankfurter Hof in Mainz zu einem kurzen Gespräch getroffen – über amerikanische Pop, den Wahn der Gesellschaft und natürlich auch seine schriftstellerischen Zukunftspläne.
Frank Witzel, Buchpreisträger und Autor des alle Rahmen sprengenden Romans »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969«, hat uns vor seiner Lesung im Frankfurter Hof in Mainz zu einem kurzen Gespräch getroffen – über amerikanische Pop, den Wahn der Gesellschaft und natürlich auch seine schriftstellerischen Zukunftspläne.
Ars gratia Artis – Oder so.
 Das in Amerika mittlerweile zu einem regelrechten Hype gewordene Crowdfunding-Prinzip
Das in Amerika mittlerweile zu einem regelrechten Hype gewordene Crowdfunding-Prinzip
schlägt mittlerweile auch in Deutschland Wellen, wenn auch noch recht bescheidene. Immerhin schaffte es die Produktion des Stromberg-Kinofilms innerhalb kürzester Zeit eine Millionen Euro einzusammeln, wohingegen kleinere Filmemacher mit ihren Projekten nur zu oft zu kurz kommen. Auch in anderen Sparten der Medienwelt, beispielsweise im Video- und Brettspiel-Bereich, erfreuen sich die deutschen Pendants der Firma Kickstarter reger Beliebtheit. Nur in einer nicht.
Noch jemand zugestiegen?
 Es ist schon verhext: Hunderte Male steigt man in den Zug, fährt von A nach B, liest dazwischen ein gutes Buch und steigt wieder aus. Und dann liegt auf einmal alles lahm, Bahnhöfe erinnern an Flüchtlingslager in der dritten Welt und alle schimpfen, mit unterschiedlichen Sündenböcken, vor sich hin. Als wäre das alles vorauszusehen gewesen, erschien kurz vor der Buchmesse ein kleines, auf den ersten Blick unscheinbares Büchlein im Wagenbach-Verlag. „Störung im Betriebslauf“ steht in nüchternen, schwarzen Lettern auf dem himmelblauen Cover, das mehr an einen S-Bahn-Fahrplan erinnert als an ein literarisches Produkt, und doch verbirgt sich hinter der schlichten Aufmachung eine der besten Ideen des Jahres. Weiterlesen
Es ist schon verhext: Hunderte Male steigt man in den Zug, fährt von A nach B, liest dazwischen ein gutes Buch und steigt wieder aus. Und dann liegt auf einmal alles lahm, Bahnhöfe erinnern an Flüchtlingslager in der dritten Welt und alle schimpfen, mit unterschiedlichen Sündenböcken, vor sich hin. Als wäre das alles vorauszusehen gewesen, erschien kurz vor der Buchmesse ein kleines, auf den ersten Blick unscheinbares Büchlein im Wagenbach-Verlag. „Störung im Betriebslauf“ steht in nüchternen, schwarzen Lettern auf dem himmelblauen Cover, das mehr an einen S-Bahn-Fahrplan erinnert als an ein literarisches Produkt, und doch verbirgt sich hinter der schlichten Aufmachung eine der besten Ideen des Jahres. Weiterlesen
Dickes B
 Aus der Sparte first world problems: Es ist noch nicht lange her, da war zu lesen, dass die ehemals coolste und hippste Stadt Deutschlands, Europas, wenn nicht gar der ganzen Welt, ihre Coolness und Hippness verloren habe. Wo früher David Bowie und Iggy Pop das Nachtleben unsicher machten, wo der Underground florierte und neue Trends und Moden entstanden, wo Rave und Techno ihre größten Erfolge feierten, habe sich eine arrogante und überhebliche Selbstgefälligkeit breitgemacht. Im Gefühl der eigenen Überlegenheit blicke der Berliner heute voll Abscheu hinab auf die durch Bars und Clubs pilgernden Touristenhorden, während ein Bezirk nach dem nächsten gehörig durchgentrifiziert werde und die Stadt nach und nach noch den letzten Rest an Charakter und Charme verliere. Am Ende einer Debatte, die, ausgelöst durch einen Beitrag im amerikanischen »Rolling Stone« und befeuert vom Internet-Portal »Gawker«, vor allem in den deutschen Medien geführt wurde, kamen selbst manche Berliner nicht umhin einzugestehen: Berlin is over. Weiterlesen
Aus der Sparte first world problems: Es ist noch nicht lange her, da war zu lesen, dass die ehemals coolste und hippste Stadt Deutschlands, Europas, wenn nicht gar der ganzen Welt, ihre Coolness und Hippness verloren habe. Wo früher David Bowie und Iggy Pop das Nachtleben unsicher machten, wo der Underground florierte und neue Trends und Moden entstanden, wo Rave und Techno ihre größten Erfolge feierten, habe sich eine arrogante und überhebliche Selbstgefälligkeit breitgemacht. Im Gefühl der eigenen Überlegenheit blicke der Berliner heute voll Abscheu hinab auf die durch Bars und Clubs pilgernden Touristenhorden, während ein Bezirk nach dem nächsten gehörig durchgentrifiziert werde und die Stadt nach und nach noch den letzten Rest an Charakter und Charme verliere. Am Ende einer Debatte, die, ausgelöst durch einen Beitrag im amerikanischen »Rolling Stone« und befeuert vom Internet-Portal »Gawker«, vor allem in den deutschen Medien geführt wurde, kamen selbst manche Berliner nicht umhin einzugestehen: Berlin is over. Weiterlesen
Ein Buch wie ein Backstein
»Blexbolex-Brikett«, so nennt die Moderatorin des Deutschlandradios im Gespräch mit Rezensentin Sylvia Schwab das Buch mit dem schlichten Titel »Ein Märchen« – der neueste Streich des in Leipzig lebenden französischen Autors und Illustrators Blexbolex. Anlass für diese Bezeichnung liefert das ungewöhnliche Format des 240 Seiten starken und etwa zehn mal zehn Zentimeter kleinen Buches, das wie ein Backstein in der Hand liegt.
Und nein, es beginnt natürlich nicht wie ein klassisches Märchen beginnen würde, die typische Einleitungsphrase à la »Es war einmal…« sucht man hier vergebens. Stattdessen kündigt eine kurze Inhaltsangabe an, was den Leser erwartet:
Diese märchenhafte Geschichte erzählt davon, was einem Kind Tag für Tag nach der Schule auf dem Nachhauseweg begegnet, und wie seine kleine Welt dabei auf einmal riesig groß wird.
»Wir haben keinen Bock darauf, älter zu werden«
 Vom Leben im Nachtleben und den damit verbundenen Hoffnungen und Sehnsüchten erzählt Ju Innerhofers »Die Bar«. Erzählerin Mia arbeitet wochenends als »erprobte Barschlampe« in einem Berliner Szeneclub, wo auch ihre beiden Freunde Jan und Viktor feiern. Berauscht von Alkohol und Drogen und getrieben von den Beats versuchen sie der Realität für einen Augenblick zu entkommen. »Die Bar« ist ein Roman über Hedonismus, Ausschweifung und die Suche nach Glück – und über das, was nach Ende des Sommers davon noch übrig bleibt.
Vom Leben im Nachtleben und den damit verbundenen Hoffnungen und Sehnsüchten erzählt Ju Innerhofers »Die Bar«. Erzählerin Mia arbeitet wochenends als »erprobte Barschlampe« in einem Berliner Szeneclub, wo auch ihre beiden Freunde Jan und Viktor feiern. Berauscht von Alkohol und Drogen und getrieben von den Beats versuchen sie der Realität für einen Augenblick zu entkommen. »Die Bar« ist ein Roman über Hedonismus, Ausschweifung und die Suche nach Glück – und über das, was nach Ende des Sommers davon noch übrig bleibt.
Wir haben Ju Innerhofer über den Dächern Berlins bei Kaffee und Zigaretten zum Interview getroffen.
Die Stadt ruft
 Man könne, schreibt David Wagner, »mit diesem Büchlein in der Hand auch sehr bequem auf dem Sofa liegend durch Berlin spazierengehen«. Das stimmt. »Welche Farbe hat Berlin« (ohne Fragezeichen!) ist ein so großartiger Reiseführer, dass er das Reisen selbst beinahe überflüssig macht. Wie Wagner mit wachem Auge und noch wacherem Geist die Straßen der bundesdeutschen Hauptstadt durchwandert und Eindrücke und Erlebnisse sammelt, ist von einer vordergründigen Einfachheit, hinter der sich aber großes Können verbirgt. Mag man anfangs noch denken, all die Skizzen, Notizen, Miniaturen und Anekdoten seien so schnell wieder vergessen, wie sie gelesen sind – bereits noch wenigen Seiten wird man den eigenen Irrtum erkennen. Dann nämlich hat einen das Buch schon um den Finger gewickelt – und man möchte auch gar nicht mehr davon loskommen, sondern kommt der Einladung zur literarischen Erkundungsreise freudig und gespannt nach. Weiterlesen
Man könne, schreibt David Wagner, »mit diesem Büchlein in der Hand auch sehr bequem auf dem Sofa liegend durch Berlin spazierengehen«. Das stimmt. »Welche Farbe hat Berlin« (ohne Fragezeichen!) ist ein so großartiger Reiseführer, dass er das Reisen selbst beinahe überflüssig macht. Wie Wagner mit wachem Auge und noch wacherem Geist die Straßen der bundesdeutschen Hauptstadt durchwandert und Eindrücke und Erlebnisse sammelt, ist von einer vordergründigen Einfachheit, hinter der sich aber großes Können verbirgt. Mag man anfangs noch denken, all die Skizzen, Notizen, Miniaturen und Anekdoten seien so schnell wieder vergessen, wie sie gelesen sind – bereits noch wenigen Seiten wird man den eigenen Irrtum erkennen. Dann nämlich hat einen das Buch schon um den Finger gewickelt – und man möchte auch gar nicht mehr davon loskommen, sondern kommt der Einladung zur literarischen Erkundungsreise freudig und gespannt nach. Weiterlesen
Der Tiger, der Torte mag

Jonas und Philip, genannt Nase und Lippe, staunen nicht schlecht, als sie bei einem Streifzug durch die örtliche Kanalisation einen Tiger, garniert mit Essenresten, Klopapier und Ähnlichem, aus dem Abwasser fischen. Es handelt sich jedoch keinesfalls um einen gewöhnlichen Tiger, sondern um einen der sprechen kann und von sich behauptet, eine alte Dame aus der Nachbarschaft zu sein:
»Ich heiße Kunigunde Ohm, bin achtundsiebzig Jahre alt und wohne in der Keunerstraße.«
Genauso selbstverständlich wie die Raubkatze dies behauptet, beschließen die beiden elfjährigen Protagonisten in Kilian Leypolds Roman »Der Tiger unter der Stadt«, sich um den Tiger, pardon, um Frau Ohm, zu kümmern. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass es sich um einen ausgewachsenen sibirischen Tiger handelt, der der größte seiner Art ist. Ihre anfänglichen Berührungsängste vor dem mächtigen Tier erweisen sich allerdings schnell als unbegründet:
»Ich kann Fleisch nur noch kauen, wenn es ganz klein geschnitten ist«, knurrte der Tiger.
»Auf was haben Sie denn Lust?«, fragte er.
»Kartoffeln mit Quark …? und später vielleicht ein Stück Kuchen oder noch besser Torte«, sagte der Tiger und blinzelte in die Sonne.
Während Tante Tiger – so nennen Philip und Jonas die alte Dame im Tigerkörper – anfangs noch nach altersgerechtem Essen und ihren zahlreichen Medikamenten verlangt, merkt sie nach und nach, dass ihr neuer Körper andere Dinge braucht – etwa rohes Fleisch statt Torte. Und sie spürt, dass sie Manches, zum Beispiel ihre Medikamente, gar nicht mehr benötigt.
» […] die Klagen wurden weniger. Zuerst verschwanden die Knie- und Gelenkschmerzen, dann die Kreislaufbeschwerden und als Letztes der Kopfschmerz.«
Der Wegfall der physischen Beschwerden ist nur ein Vorzug ihres neuen Körpers. Im Gespräch mit Jonas und Philip wird ihr klar, dass er auch ein neues Lebensgefühl mit sich bringt. Ein Lebensgefühl, das nicht mehr von Angst, Einsamkeit und Traurigkeit dominiert ist:
»Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es tut, keine Angst mehr zu haben.«
»Wovor hatten Sie denn Angst?«, fragte Lippe.
»Vor Treppen. Dass ich sie nicht mehr hinaufkomme oder hinunterpurzle. Überhaupt zu stürzen, in meiner Wohnung hilflos am Boden zu liegen und nicht mehr ans Telefon zu kommen. Angst, keine Dose und kein Einmachglas mehr aufzubekommen, und dann, wenn man zu nichts mehr Kraft hat … vor dem Ende.«
 Kilian Leypold ist es mit seinem ungewöhnlichen Roman gelungen, auf amüsante, einfühlsame und intelligent Art und Weise von dem Miteinander von Jung und Alt und dem Altwerden und Altsein überhaupt zu erzählen. Und das tut er kein bisschen schulmeisterlich, sein Roman erinnert vielmehr an ein modernes Großstadtmärchen.
Kilian Leypold ist es mit seinem ungewöhnlichen Roman gelungen, auf amüsante, einfühlsame und intelligent Art und Weise von dem Miteinander von Jung und Alt und dem Altwerden und Altsein überhaupt zu erzählen. Und das tut er kein bisschen schulmeisterlich, sein Roman erinnert vielmehr an ein modernes Großstadtmärchen.
Die entscheidende, omnipräsente Frage, die es vermag, die Spannung bis zum Schluss aufrecht zu erhalten, ist: Wie konnte Kunigunde Ohm in den Körper des Tigers gelangen? Doch das verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht. Wir empfehlen: Roman kaufen und nachlesen. Es lohnt sich.
Kilian Leypold: Der Tiger unter der Stadt. Aufbau Verlag: Berlin 2010.
Und es dreht sich und dreht sich und dreht sich …

Klaus Kordons Roman »Das Karussell« ist nach einem einfachen Kinderspielzeug benannt. Aber halt. Ist es das wirklich? Ein einfaches Kinderspielzeug? Steht ein »Karussell« nicht für viel mehr? Ist es nicht eher ein Gegenstand, der uns an die Unbeschwertheit, an die Leichtigkeit der Kindheit zurückdenken lässt? Für Kordon hat mit diesem Karussell angefangen, wovon er in seinem neuen Roman (nach »Das Krokodil« und »Auf der Sonnenseite« sein dritter autobiographischer Roman) schreibt. Als Kind fand er es beim Stöbern in einer alten, verschlossenen Kommode:
[…] zwischen allerlei Krimskrams wie alten Papiertüten, Watteresten und Kerzenstummeln stand ein kleines, bunt angemaltes, blechernes Karussell. Es war sehr verstaubt und an manchen Stellen war bereits der Lack abgeplatzt.
Verständlicherweise wundert es ihn, zwischen all dem anderen Gerümpel ein Kinderspielzeug zu finden, das er nie zuvor gesehen hat. Seine Mutter sagt ihm schließlich, dass das Karussell seinem Vater, der Soldat im Zweiten Weltkrieg war und an der Ostfront verschollen ist, gehört hat. Sie verspricht ihm alles zu erzählen, was sie vom Vater weiß – und Kordon erzählt es uns. »Das Karussell« ist die Geschichte von seinen Eltern, von Herbert Lenz und Lisa Gerber.
Zunächst sind es aber zwei Geschichten: Da ist die Geschichte von Herbert, genannt Bertie, der in einem Berliner Waisenhaus lebt und zwar eine Mutter hat, aber ohne sie aufwachsen muss. Alles was ihm von ihr bleibt sind mal mehr, mal weniger regelmäßige Besuche im Waisenhaus. Ihn quält in seiner Kindheit vor allem die Frage, warum seine Mutter ihn abgegeben hat und – besonders nachdem sie geheiratet hat, schließlich sogar ein zweites Kind bekommt – nicht zu sich nimmt. Erst Jahre später, Bertie ist inzwischen erwachsen, wird ihm klar, was er schon als Kind geahnt hat:
Er wich zurück. Der Blick, mit dem sie ihn ansah! Ein Blick, der sie endgültig verriet. Sie warf ihm vor, dass es ihn gab! Er, ihr Sohn, hatte sie ins Unglück gestürzt.
Von diesem Augenblick an, ist seine Mutter für ihn nicht mehr existent – späte Annäherungsversuche ihrerseits weist er zurück.
Und da ist die Geschichte von Lisa Gerber, die zusammen mit drei jüngeren Geschwistern eine geborgene Kindheit im Harz erlebt bis der Vater im Ersten Weltkrieg ums Leben kommt. Lotte Gerber, die Mutter, erinnert sich an die Worte des Vaters (»Bier geht immer«) als sie beschließt, einen Neuanfang zu wagen: Ihr Weg führt sie und ihre Kinder von Thale über Zerbst, wo sie drei Jahre lang erfolgreich eine Gastwirtschaft führt, nach Berlin. Hier werden die beiden Erzählstränge miteinander verknüpft, denn Lisa, mittlerweile Anfang 30 und selbst Wirtin in einem Lokal im Prenzlauer Berg, lernt den Maurergesellen Bertie kennen, der bei ihr sein Feierabendbier trinkt. Sie verlieben sich ineinander, doch ihr Glück währt nicht lange, der Zweite Weltkrieg hat bereits begonnen.
 In einem Fernseh-Interview erzählt Klaus Kordon, dass er erst recherchieren musste, um diesen Roman zu schreiben. Ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass er darin die eigene Familiengeschichte erzählt, aber verständlich, wenn man diese Geschichte dann kennt. So hat er in der Charité die Geburtsurkunde des Vaters gefunden, der 1908 von einem 16 Jahre alten, ledigen Dienstmädchen zur Welt gebracht worden ist. Und in der Deutschen Dienststelle die Karteikarte, die Auskunft über den Wehrmachtssoldat Herbert Kordon (im Roman »Lenz«) gibt, etwa welche Feldpostnummer er hatte, in welchem Zeitraum er im Lazarett oder auf Fronturlaub war. Nur wie und wo sein Vater gestorben ist, das hat er auch hier nicht erfahren.
In einem Fernseh-Interview erzählt Klaus Kordon, dass er erst recherchieren musste, um diesen Roman zu schreiben. Ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass er darin die eigene Familiengeschichte erzählt, aber verständlich, wenn man diese Geschichte dann kennt. So hat er in der Charité die Geburtsurkunde des Vaters gefunden, der 1908 von einem 16 Jahre alten, ledigen Dienstmädchen zur Welt gebracht worden ist. Und in der Deutschen Dienststelle die Karteikarte, die Auskunft über den Wehrmachtssoldat Herbert Kordon (im Roman »Lenz«) gibt, etwa welche Feldpostnummer er hatte, in welchem Zeitraum er im Lazarett oder auf Fronturlaub war. Nur wie und wo sein Vater gestorben ist, das hat er auch hier nicht erfahren.
Im Interview verrät er einen weiteren Grund, warum sein Roman »Das Karussell« heißt: Ein Karussell drehe sich im Kreis, so Kordon, alles wiederhole sich und auch in seiner Familie haben sich viele Schicksale wiederholt: So habe sich seine Mutter beispielsweise gefragt, ob – nachdem ihr Vater und ihr Mann im Krieg gefallen sind – auch ihre Söhne einem Krieg zum Opfer fallen würden. Und nicht nur Kordons Vater hat viele Jahre im Waisenhaus verbracht, auch Kordon selbst lebte nach dem frühen Tod der Mutter fünf Jahre erst in einem Kinder-, später dann Jugendheim. Sogar seine eigenen Kinder mussten 1972 nach einem missglückten Fluchtversuch aus der DDR zwei Jahre in einem Heim leben, bevor sie zu den Eltern, die vom Westen freigekauft worden waren, zurückkehren durften.
Dass sein Vater so viel Unrecht und soviel Pech in seinem Leben gehabt hat, habe ihn schon als Kind beschäftigt. Mit diesem Roman sagt er, habe er ihm vielleicht ein Denkmal setzen wollen, wollte, dass seine Geschichte nicht vergessen wird. Es ist ihm gelungen.
Klaus Kordon: Das Karussell. Beltz & Gelberg: Weinheim u.a. 2012.
Klaus Kordon im Interview mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg
