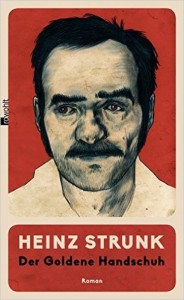 Eines vorweg: Dieses Buch zu lesen ist wie im Dreck zu baden. Oder wie einen mit Bier verdünnten Aschenbecher auszutrinken (was so ähnlich im Roman auch vorkommt). Dieses Buch zu lesen heißt, selbst den Goldenen Handschuh zu betreten, »Hohe Klasse« oder »Fako« (Fanta-Korn) zu trinken, die Kopfschmerzen, die Hirngespinste, die Ausfall- und Entzugserscheinungen der Figuren mitzuerleben und die Houellebecq’sche Sicht auf den Menschen zu teilen. »Der goldene Handschuh« ist ein rasendes, nihilistisches Werk; eine Geisterbahnfahrt durch die elendigsten Köpfe St. Paulis; ein Tagesausflug ins pathologisch Perverse; ein Blockbuster des Elends.
Eines vorweg: Dieses Buch zu lesen ist wie im Dreck zu baden. Oder wie einen mit Bier verdünnten Aschenbecher auszutrinken (was so ähnlich im Roman auch vorkommt). Dieses Buch zu lesen heißt, selbst den Goldenen Handschuh zu betreten, »Hohe Klasse« oder »Fako« (Fanta-Korn) zu trinken, die Kopfschmerzen, die Hirngespinste, die Ausfall- und Entzugserscheinungen der Figuren mitzuerleben und die Houellebecq’sche Sicht auf den Menschen zu teilen. »Der goldene Handschuh« ist ein rasendes, nihilistisches Werk; eine Geisterbahnfahrt durch die elendigsten Köpfe St. Paulis; ein Tagesausflug ins pathologisch Perverse; ein Blockbuster des Elends.
Heinz Strunk hat in seinem Roman eine Parallelwelt porträtiert, die man so oder so ähnlich zwar schon bei Bukowski und Fauser gesehen hat, aber gänzlich ohne deren durch den Alkohol verklärten Blick, ohne den romantisierenden Schleier auskommt, der noch die übelste Spelunke in feinste Sepiafarben taucht und noch den letzten Scheißtag poetisiert. Doch diese Radikalität überrascht nicht, handelt es sich hier schließlich um die Geschichte eines Serienmörders: Fritz Honka hat zwischen 1970 und 75 vier Frauen auf bestialische Art und Weise umgebracht.
Abgeschleppt hat er sie alle aus dem Handschuh, einer Hamburger Absturzkneipe, die tief blicken lässt in die Verlorenen und Fremden unter uns. So ist der Roman auch eher eine Milieustudie als ein beinharter »True Crime«-Bericht. Honka stellt dementsprechend keinen Jack the Ripper oder Son of Sam dar, die alle eine Aura des Bedrohlichen und Geheimnisvollen umgibt. Auch fehlt ihm das Dämonische eines Fritz Haarmann. In einer Reihe mit den schlimmsten Mördern der Geschichte würde er kaum auffallen, der kleine schielende Mann mit dem schiefen Gesicht und der traurigen Biographie.
Nein, er war bestimmt kein Mastermind des Verbrechens. Wann immer ihn seine Opfer oder sein Bruder in der kleinen achtzehn Quadratmeter großen Dachwohnung besuchten und ihn auf den bestialischen Geruch aufmerksam machten (die Verwesung), entgegnete er stets, das wären die Griechen von unten, die kochen da ständig irgendwas zusammen.
Ja, er war ein Würstchen vor dem Herrn. Die Frauen, die bei ihm Zuflucht suchten und den Tod fanden, gewöhnliche Hausfrauen, hatten oft keine Bleibe oder waren Gelegenheitsprostituierte. Das Leben hatte sie schnell altern lassen und so sahen sie auch aus. Honka, genannt Fiete (»Diesen Spitznamen hat der Schiefe erst vor kurzem verpasst bekommen. Er weiß nicht mehr, von wem und warum, aber er hatte noch nie einen, und es macht ihn richtig stolz. […] Ein Spitzname […] bedeutet hier eine Auszeichnung und kommt einem Adelstitel gleich.«) bediente sich beim Bodensatz. Wer wäre sonst mitgekommen?
Man kann sich beim Lesen nur schwer entscheiden, wer nun das größere Opfer ist: Honka oder die Mordopfer. Aber das ist nicht alles, was der Roman bietet. Zusätzlich zu der düsteren Erzählung um einen alkoholkranken Frauenmörder, liefert Strunk Einblicke in eine Reederfamilie, die hinter ihrer gutbürgerlichen Fassade genauso viel existenzielle Nacktheit und Verkommenheit versteckt wie es Honka bald nicht mehr kann (es geht auch nicht darum, ob er geschnappt wird, sondern einzig und allein darum, wann). Fernab von Klassenunterschieden sind wir in unserer sexuellen Raserei und verzweifelt ums uns schlagenden Emotionalität alle gleich. Da schmeckt man die »Ausweitung der Kampfzone« förmlich heraus. »Der goldene Handschuh« ist ebenso unerbittlich.
Strunk zeichnet das Porträt einer Welt, die auf dem heute gentrifzierten Hamburger Berg kaum mehr möglich scheint. Wo einmal berühmte Kiezkneipen waren, stehen jetzt Neubauten, mit Gastronomiebetrieben und Studentenwohnheimen. Kein Platz mehr für Fiete, für Soldaten-Norbert, Glatzen-Dieter oder Fanta-Rolf, obwohl sie noch da sind, irgendwo in den Ritzen des gesellschaftlichen Lebens. Auch wenn die Stadt alles dafür tut, so zu tun, als gäbe es sie nicht.
Heinz Strunk: Der Goldene Handschuh. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg 2016.
