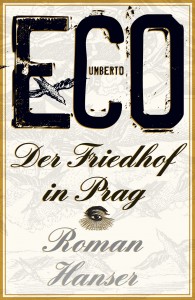Liegt die Zukunft bereits hinter uns? Benjamin Stein entwirft in seiner kühlen sozial-medialen Utopie »Replay« das Bild eines gläsernen Menschen, der sich freiwillig der Diktatur der Technologie unterwirft.
Liegt die Zukunft bereits hinter uns? Benjamin Stein entwirft in seiner kühlen sozial-medialen Utopie »Replay« das Bild eines gläsernen Menschen, der sich freiwillig der Diktatur der Technologie unterwirft.
Menschen tragen in dieser nahen Zukunft ein Implantat namens »UniCom«. Es zeichnet die Bilder des Lebens auf: Erwachen, den Gang zur Toilette, Gespräche, erotische Erlebnisse. Alles kann der Träger im Nachhinein bearbeiten, er kann die aufgezeichneten Bilder immer wieder neu betrachten und durchleben. Und das Beste: All diese beliebigen, persönlichen Augenblicke können über eine Datenbank mit anderen Implantat-Trägern geteilt werden, die wiederum all diese Erlebnisse selbst durchleben können.
Es ist das Weiterspinnen des Social-Media-Wahns, wie wir ihn bisher kennen: Menschen filmen oder fotografieren ihr Leben, platzieren diese Aufnahmen im Internet, während die Betrachter der Aufzeichnungen zu jeder Zeit diese kommentieren und bewerten können. Diese Welt, die Benjamin Stein in seinem dritten Roman entwirft, die gibt es schon – doch ist sie noch nicht ganz so pervers und hypersozial, wie sie in »Replay« vorgedacht wird.
Ich fürchte mich vor Erscheinungen, die ich nicht selbst erfunden habe.
Die Geschichte ist schnell umrissen: Der Chefentwickler des Implantats, Ed Rosen, hat sich verfangen in dieser Welt, zwischen Aufzeichnungen und gegenwärtig Erlebtem. Der Leser ahnt dies schon bald, doch verfällt auch er der Faszination der Reproduktion des Erlebten. Im Vordergrund stehen hierbei sexuelle Ereignisse, die Ed Rosen immer wieder vor dem geistigen Auge abspielen lässt, sie immer wieder neu durchlebt. Es spielt keine Rolle, wie viel Zeit seit der Aufzeichnung vergangen ist – denn die Gegenwart ist uninteressant, sofern sie das Aufgezeichnete nicht überbieten kann. Was zählt, das ist einzig die Realität, die das »UniCom« seinem Träger vorspielt. Das Glück, so will es Ed Rosen, ist ein immerwährender und immer abrufbarer Zustand.
Der Verführung dieses radikalen Konstruktivismus, den Benjamin Stein in »Replay« beschreibt, kann sich der Leser kaum erwehren: Die Realität wird von den Trägern des »UniCom« im Geiste konstruiert, es ist ein willkürliches Springen zwischen den intensivsten, schönsten Aufzeichnungen des bisherigen Lebens und den damit einhergehenden Sinnesreizen. Fast scheint dies wie eine Spielart des Solipsismus: Ein paar gute Jahre und glückliche Momente reichen dem Träger des »UniComs« aus, um sich seine Welt aus den Erinnerungen immer wieder neu zusammenzubauen. Eine tatsächliche Welt brauchte es nicht mehr. Das Bewusstsein schafft sie sich schon selbst.
Die Pornoindustrie, die damals wegen der vielen freien Quellen im Netz kränkelnd darniederlag, sprang mit Begeisterung auf den Zug auf.

Ed Rosen, Entwickler und erster Träger des »UniComs«, steht dem Implantat unvoreingenommen und naiv gegenüber. Man würde ihm gerne Dürrenmatts »Die Physiker« in sein »UniCom« eintrichtern, ihm seine Verantwortung für diese soziale Diktatur verdeutlichen. Stattdessen beobachtet man sich selbst, wie man Freunden via Facebook den visuellen Buchtrailer des Buches auf die Pinnwand postet. Die totale Transparenz, das stetige Konsumieren von Glück ist verführerisch – doch macht es auch stumpf und abhängig. Kann man dieser Sucht entrinnen? Ed Rosen beantwortet diese Frage am Ende des Romans.
Krell leuchten die Warnsignale in just diesem Moment, in dem Rosen von seinem Kompagnon Matana über das Wesen sozialer Netzwerkdienste unterrichtet wird:
»Es gibt in diesen wuchernden Systemen so gut wie keine Funktion negativer Rückkopplung. Man kann Interessantes weiterverbreiten und Beiträge anderer mit einem Klick auf den Like-Button adeln. Einen Dislike-Button hingegen gibt es nicht. Kein Benutzer wird darüber informiert, wenn er von anderen geblockt wurde. Das System bietet nur Funktionen an, die zur noch intensiveren Nutzung des Systems motivieren. Sie animieren dazu, mehr und mehr Menschen zu involvieren.«
Und weiter: »Es ist wie eine Umpolung des Wattschen Dampfreglers. Je schneller die Maschine dreht, desto mehr Dampf gibt das Ventil frei. Systemtheoretisch betrachtet, kann ein solches dynamisches System, das sich allein auf positive Rückkopplung stützt, nur in die Katastrophe steuern. Aus winzigen Turbulenzen werden wahre Stürme, eine sich immer schneller drehende Spirale ungebremster Wucherung.«
Ich höre den Jingle der Corporation, und kaum hat der erste Beitrag begonnen, habe ich gar keine Lust mehr, aufzustehen und aus dem Haus zu gehen.
Wohin die Reise führt? Sicherlich nicht in die Unendlichkeit. Es ist eine grandiose Selbsttäuschung, eine Utopie, die bitter schmeckt, weil sie nicht wirklich utopisch zu sein scheint. Benjamin Stein hat mit »Replay« einen Roman geschrieben, der lange nachwirkt, der Angst macht, entsetzt. Und den man nicht aus der Hand legen kann, ehe man ihn zu Ende gelesen hat.
Benjamin Stein: »Replay«. C.H. Beck: München 2012.

 Dietmar Dath, Schriftsteller und Journalist, und Barbara Kirchner, Professorin für theoretische Chemie, haben ein Buch geschrieben mit dem sperrigen Titel »Der Implex. Sozialer Fortschritt: Geschichte und Idee«. Doch ist der Titel allein, verglichen mit dem, was die Lektüre dieses buchgewordenen Ungetüms dem geneigten Leser abverlangt, noch vergleichsweise harmlos, denn auf gut 800 Seiten gehen Dath und Kirchner der Frage nach, »ob und wie so etwas wie sozialer Fortschritt gedacht und, wichtiger, gemacht werden kann«. Dazu durchforsten sie die Tiefen und Untiefen von Wissenschaft und Philosophie, Kunst und Literatur und picken sich heraus, was ihnen gelegen kommt und was gerade passt. Das Resultat ist ein Buch, das in seiner Komplexität und Vielschichtigkeit kaum zu fassen ist, so vollgepackt mit Informationen, Reflexionen und Ideen ist es.
Dietmar Dath, Schriftsteller und Journalist, und Barbara Kirchner, Professorin für theoretische Chemie, haben ein Buch geschrieben mit dem sperrigen Titel »Der Implex. Sozialer Fortschritt: Geschichte und Idee«. Doch ist der Titel allein, verglichen mit dem, was die Lektüre dieses buchgewordenen Ungetüms dem geneigten Leser abverlangt, noch vergleichsweise harmlos, denn auf gut 800 Seiten gehen Dath und Kirchner der Frage nach, »ob und wie so etwas wie sozialer Fortschritt gedacht und, wichtiger, gemacht werden kann«. Dazu durchforsten sie die Tiefen und Untiefen von Wissenschaft und Philosophie, Kunst und Literatur und picken sich heraus, was ihnen gelegen kommt und was gerade passt. Das Resultat ist ein Buch, das in seiner Komplexität und Vielschichtigkeit kaum zu fassen ist, so vollgepackt mit Informationen, Reflexionen und Ideen ist es. 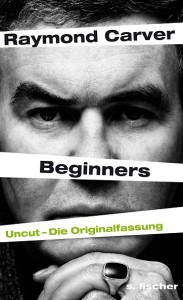


 An die Arbeitsweise des Journalisten richten sich besondere Ansprüche. So hat sich ein Journalist natürlich an die Fakten zu halten, klar, aber Fakten können auch der Literatur als Grundlage dienen. Wo ist also der Unterschied? Vielleicht liegt der Unterschied darin, dass Literatur nicht »wahr« sein muss, während ein journalistischer Text sehr wohl einer »Wahrheit« verpflichtet ist, um es pathetisch zu sagen. Aber was heißt das, einer »Wahrheit« verpflichtet zu sein? Worin besteht diese »Wahrheit« des Journalismus? Das ist keine rhetorische Frage, im Gegenteil. Zweifellos ist es eine grundlegende Frage, aber darum ist sie nicht weniger komplex. Was macht also einen gelungenen journalistischen Beitrag, einen »wahren« Beitrag aus? Zumindest im deutschsprachigen Raum wird diese Frage oft mit dem seltsamen Wort »Objektivität« beantwortet. Dagegen ist zweierlei einzuwenden: Erstens, dass es diese Objektivität, außer vielleicht als Ideal, nicht gibt und nicht geben kann. Man kann sich einem Sachverhalt von unterschiedlichen Seiten nähern, man kann verschiedene Zugänge einander entgegen halten und abwägen, aber das ist nicht objektiv, sondern allenfalls intersubjektiv, und auch dies nur in einem beschränkten Maße. Und zweitens, dass der Anspruch auf Objektivität leider mitunter dazu führt, dass journalistischen Texte eine Nüchternheit, ja man möchte sagen: eine Langeweile und eine Ödnis an den Tag legen, weil sie der irrigen Annahme folgen, dass der Verzicht auf rhetorische Mittel und sprachliche Finessen einen Text automatisch objektiv mache – nach dem Motto: nichts wagen, auch nicht sprachlich, und bloß nicht »ich« sagen.
An die Arbeitsweise des Journalisten richten sich besondere Ansprüche. So hat sich ein Journalist natürlich an die Fakten zu halten, klar, aber Fakten können auch der Literatur als Grundlage dienen. Wo ist also der Unterschied? Vielleicht liegt der Unterschied darin, dass Literatur nicht »wahr« sein muss, während ein journalistischer Text sehr wohl einer »Wahrheit« verpflichtet ist, um es pathetisch zu sagen. Aber was heißt das, einer »Wahrheit« verpflichtet zu sein? Worin besteht diese »Wahrheit« des Journalismus? Das ist keine rhetorische Frage, im Gegenteil. Zweifellos ist es eine grundlegende Frage, aber darum ist sie nicht weniger komplex. Was macht also einen gelungenen journalistischen Beitrag, einen »wahren« Beitrag aus? Zumindest im deutschsprachigen Raum wird diese Frage oft mit dem seltsamen Wort »Objektivität« beantwortet. Dagegen ist zweierlei einzuwenden: Erstens, dass es diese Objektivität, außer vielleicht als Ideal, nicht gibt und nicht geben kann. Man kann sich einem Sachverhalt von unterschiedlichen Seiten nähern, man kann verschiedene Zugänge einander entgegen halten und abwägen, aber das ist nicht objektiv, sondern allenfalls intersubjektiv, und auch dies nur in einem beschränkten Maße. Und zweitens, dass der Anspruch auf Objektivität leider mitunter dazu führt, dass journalistischen Texte eine Nüchternheit, ja man möchte sagen: eine Langeweile und eine Ödnis an den Tag legen, weil sie der irrigen Annahme folgen, dass der Verzicht auf rhetorische Mittel und sprachliche Finessen einen Text automatisch objektiv mache – nach dem Motto: nichts wagen, auch nicht sprachlich, und bloß nicht »ich« sagen.  Joachim Lottmann. Der »Erfinder der deutschsprachigen Popliteratur«. Der »Erfolgsschriftsteller«. Der »Anti-Goetz«. Joachim Lottmann ist wieder da. War er denn jemals weg? Nein, eigentlich nicht. Und hat sich etwas geändert im »Kosmos Lottmann«? Nein, eigentlich nicht. Lottmann geht unbeirrt seinen Weg und schreibt wie er immer schreibt. Immerhin eine Konstante bei all den Höhen und Tiefen in Lottmanns Leben, von dem ja seine Erzählungen und Romane handeln – zumindest, wenn man dem Verfasser glaubt. Denn, so schreibt Lottmann in seinem Blog, seine Bücher basieren allesamt auf Erlebnissen, die zunächst in Tagebuchform festgehalten sind und die anschließend eine literarische Umsetzung gefunden haben.
Joachim Lottmann. Der »Erfinder der deutschsprachigen Popliteratur«. Der »Erfolgsschriftsteller«. Der »Anti-Goetz«. Joachim Lottmann ist wieder da. War er denn jemals weg? Nein, eigentlich nicht. Und hat sich etwas geändert im »Kosmos Lottmann«? Nein, eigentlich nicht. Lottmann geht unbeirrt seinen Weg und schreibt wie er immer schreibt. Immerhin eine Konstante bei all den Höhen und Tiefen in Lottmanns Leben, von dem ja seine Erzählungen und Romane handeln – zumindest, wenn man dem Verfasser glaubt. Denn, so schreibt Lottmann in seinem Blog, seine Bücher basieren allesamt auf Erlebnissen, die zunächst in Tagebuchform festgehalten sind und die anschließend eine literarische Umsetzung gefunden haben.