Bei Suhrkamp sitzen auch Strategen, man glaubt es kaum, und sie schlagen dem Medienunternehmer Hans Barlach und seinen Freunden ein Schnippchen. Ein Schutzschirmverfahren soll helfen, das traditionsreiche Verlagshaus auf neuen Kurs, auf gesunden Kurs, zu bringen. Der insolvenzgefährdete Verlag um Ulla Unseld-Berkéwicz will dadurch verhindern, dass Gewinne nicht an Anteilseigner ausgeschüttet werden, sondern weiterhin in die Verlagsarbeit fließen können. »Die Geschäftsführung des Verlags ist der Überzeugung, dass innerhalb dieses Verfahrens ein stabiler finanzieller und rechtlicher Rahmen für die Fortführung des Verlags gefunden werden kann«, sagt der Verlag und wir drücken die Daumen.
Archiv des Autors: Christian Preußer
Wettlesen für alle
Gestern, also am Montag, da war es soweit: Die Namen der nächsten 14 Autoren, die in den Ring geschickt werden, um vor einer unüberwindbaren Jury zu bestehen, wurden veröffentlicht. Ohne Brimborium. Auf einer Internetseite. Die Portraitfotos können es nicht verraten, doch ist zu erwarten, wie jedes Mal, in jedem Jahr: Kunst, große Kunst, größere Kunst, Schrott. Wir setzen unser ganzes Hab und Gut auf Roman Ehrlich und Heinz Melle und stellen schon mal das Bier kalt. Denn der Juli ist bald da.
Der große Preis von Leipzig
Überraschung, Überraschung: Zu den Nominierten des diesjährigen »Preis der Leipziger Buchmesse« zählt die 29-jährige Freiburger Schriftstellerin Lisa Kränzler, die für ihren zweiten Roman »Nachhinein« nominiert wurde. Kränzlers Lesung beim letztjährigen Bachmann-Preis war eine einzige Freude, weswegen wir ihr und dem Verbrecher Verlag unsere acht Daumen kräftig drücken. Weiterlesen
Farbe bekennen?
Die Spiegel-Online-Autorin Hannah Pilarczyk bescheinigt Literaturkritiker Denis Scheck eine rassistische Gesinnung. Scheck hat sich in seiner ARD-Sendung »Druckfrisch« schwarz angemalt und Stellung zur Rassismus-Debatte in Kinderbüchern bezogen.
Pilarczyk schreibt: »Genau wie das Wort Neger steht die Praxis, sich das Gesicht schwarz anzumalen, in einer rassistischen Tradition: In den Minstrel-Shows, die nach dem Bürgerkrieg in den USA sehr populär waren, malten sich weiße Amerikaner ihre Gesichter an, um sich über Schwarze lustig zu machen, um sie als dumm und als faul darzustellen. […] Was man Scheck allerdings zugestehen muss, ist eine Konsequenz, die andere Kommentatoren in der Kinderbuch-Debatte bisher nicht gezeigt haben. Sein schwarzes Gesicht ist sozusagen die visuelle Repräsentation dessen, was in der Kinderbuch-Debatte Land auf, Land ab gefordert worden ist: das Festhalten an Begriffen, deren rassistischer Ursprung unbestritten ist. Scheck hat diese Forderung nur theatralisch ausagiert.«
Der Auftritt von Scheck ist unglücklich, mindestens naiv und nutzt ein fragwürdiges Stilmittel. Dabei hätte Scheck doch ahnen können, was ihn erwarten würde.
Der Klang des Widerspruchs
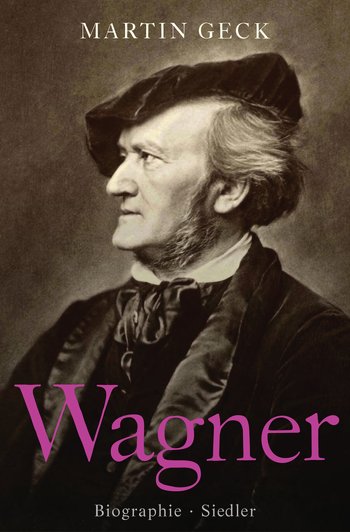 »Verachtet mir die Meister nicht«: Im Mai beginnen die Feuilleton-Festspiele zu Richard Wagners 200. Geburtstag. Zur rechten Zeit hat sich eine Schwemme von Veröffentlichungen angekündigt, die allesamt das Leben des Komponisten beleuchten wollen. Die vielversprechendste Biographie hat der Musikwissenschaftler Martin Geck geschrieben. Sicherheitshalber hat der Siedler-Verlag sie schon im vergangenen Oktober veröffentlicht. »Wagner« heißt das Buch lapidar und ist gar keine Biographie. Zumindest nicht im Sinne des eigentlichen Wortgebrauchs. Vielmehr geht Geck in seinem knapp 400 Seiten umfassenden Rundumschlag analytisch auf das Schaffen Richard Wagners ein und unterteilt es in 14 Kapitel. Da wird der »Lohengrin« seziert, »Der Ring des Nibelungen« als Mythos des 19. Jahrhunderts durchleuchtet und der Sarkasmus der prätentiösen »Meistersinger“ untersucht. Weiterlesen
»Verachtet mir die Meister nicht«: Im Mai beginnen die Feuilleton-Festspiele zu Richard Wagners 200. Geburtstag. Zur rechten Zeit hat sich eine Schwemme von Veröffentlichungen angekündigt, die allesamt das Leben des Komponisten beleuchten wollen. Die vielversprechendste Biographie hat der Musikwissenschaftler Martin Geck geschrieben. Sicherheitshalber hat der Siedler-Verlag sie schon im vergangenen Oktober veröffentlicht. »Wagner« heißt das Buch lapidar und ist gar keine Biographie. Zumindest nicht im Sinne des eigentlichen Wortgebrauchs. Vielmehr geht Geck in seinem knapp 400 Seiten umfassenden Rundumschlag analytisch auf das Schaffen Richard Wagners ein und unterteilt es in 14 Kapitel. Da wird der »Lohengrin« seziert, »Der Ring des Nibelungen« als Mythos des 19. Jahrhunderts durchleuchtet und der Sarkasmus der prätentiösen »Meistersinger“ untersucht. Weiterlesen
Das miese Leben
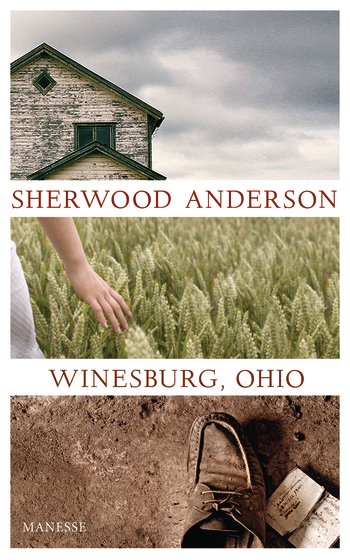 Zuhause ist es immer noch am schrecklichsten. Da geht man über die Straße und wird gegrüßt von einem, den man doch eigentlich gar nicht mehr kennen will. Der Nachbar wünscht einen guten Tag, doch weiß man: gerade eben hat er hinter verschlossener Tür seine Frau angeschrien. Und am schlimmsten: die eigenen Geheimnisse stehen für alle sichtbar auf der gerunzelten Stirn geschrieben.
Zuhause ist es immer noch am schrecklichsten. Da geht man über die Straße und wird gegrüßt von einem, den man doch eigentlich gar nicht mehr kennen will. Der Nachbar wünscht einen guten Tag, doch weiß man: gerade eben hat er hinter verschlossener Tür seine Frau angeschrien. Und am schlimmsten: die eigenen Geheimnisse stehen für alle sichtbar auf der gerunzelten Stirn geschrieben.
Sherwood Anderson hat über die kleinen privaten Geheimnisse, Schrecklichkeiten, Abgründe ein Buch geschrieben, das vielleicht schönste Buch, das während des ersten Weltkriegs verfasst wurde. »Winesburg, Ohio« heißt dieses Portrait einer Kleinstadt im nördlichen Nirgendwo Amerikas und dort, in diesem fiktiven Ort, spielt sich auch das Geschehen ab: Junge Männer hadern mit ihrer Zukunft, die Alten versinken in Depressionen, die Frauen sind vergrämt und ein quirliger Reporter der Lokalzeitung »Winesburg Eagle« bringt sie alle zusammen. Mit dem Progressivismus und kurz vor dem Beginn der Industrialisierung verlieren die Menschen die Nerven und den Sinn für die Traditionen des Landlebens. Die Stadt lockt mit Versprechungen, doch wer wagt schon den ersten Schritt ins Neue? Weiterlesen
Der Untergang des Bademantels

Handtücher kann man noch nicht aus dem Internet herunterladen. Und trotzdem steht die Frottee-Firma »Tietjen & Söhne« vor dem Aus. In ihrem dritten Roman erzählt Nora Bossong schwungvoll vom Aufstieg und Fall eines Essener Familienunternehmens. Einem Unternehmen, dem es nicht gelingen will, in dieser globalisierten Welt Fuß zu fassen.
Rund 100 Jahre hat die Firma auf dem Buckel, der Gründer Justus Tietjen konnte einst das kaiserliche Heer mit Handtüchern aus dem Hause »Tietjen & Söhne« versorgen. Es war der größte Triumph der Firmengeschichte. Die Nachfahren Justus Tietjens verwalten die Firma, machen aus ihr sogar kurzzeitig eine Luxus-Marke. Welche Rolle »Tietjen & Söhne« bei den Nazis spielte, das wird innerhalb der Familie verschwiegen. Ein Handtuch, auf dem ein kleines Hackenkreuz gestickt ist, verschwindet still und leise. New York will die Firma ab den Fünfzigern erobern. Ein Plan, an dem die jeweiligen Geschäftsführer kläglich scheitern. Auch Kurt Tietjen, der den Laden in den Achtzigern übernimmt, wird an der Metropole scheitern.
Es klang wie ein leiser Zweifel, aber Kurt wusste, dass es mehr als das war.
Nora Bossong erzählt in »Gesellschaft mit beschränkter Haftung« von einer Welt, die nahe zusammengerückt ist und keine Schwachen, Zweifler, Abwägenden gebrauchen kann. Es ist ein Generationen-, ein Bildungs-, ein Firmen-Roman. Es ist ein Buch, einmal angefangen zu lesen, das man nicht aus der Hand legen wird.
Die Crux der Determination: Kurt Tietjen will sich in der Rolle als Chef von knapp 250 Mitarbeitern nicht gefallen. Er ist hineingeboren, in diese harte Hierarchie und sein Vater macht ihm stets deutlich: »Ohne die Firma gäbe es weder dich noch mich!« Die Firma wird auch zum Mittelpunkt des Lebens von Kurt, der eine Frau heiratet, für die er zwar keine innige Liebe empfindet, aber immerhin lässt sie ihn in Frieden. Im Laufe der Jahre beginnt Kurt zu grübeln: Was ist Freiheit? Ist dieses Leben überhaupt lebenswert? Trotz des Wohlstands?
Ihm war nicht nach Reisen zumute. Ihm war nicht einmal danach zumute, anwesend zu sein.
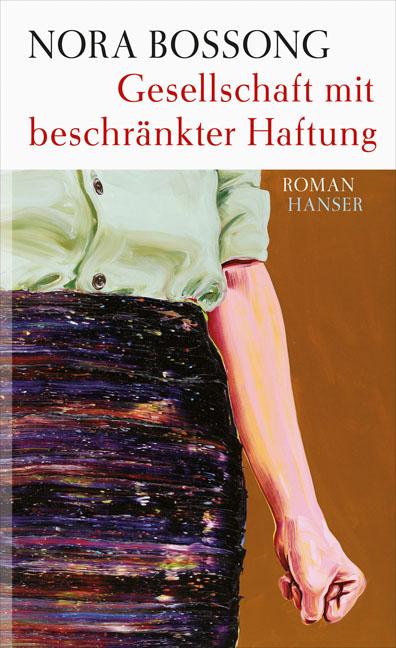 Den Verpflichtungen überdrüssig, taucht Kurt am Ende seiner beruflichen Karriere in den dunklen Gassen New Yorks ab. Luise Tietjen, Kurts Tochter, muss nun die Geschäftsführung von »Tietjen & Söhne« übernehmen. Luise, gerade im Begriff, ihr Philosophie-Studium zu beenden, schlägt sich nun mit Gläubigern herum, mit Analysten und selbstgerechten Firmenteilhabern. Stets hat sie ihren Vater für seine Arroganz und sein Desinteresse verachtet, nun stürzt sie selbst kopfüber in die Hölle der Abhängigkeiten und nimmt Charakterzüge des Vaters an.
Den Verpflichtungen überdrüssig, taucht Kurt am Ende seiner beruflichen Karriere in den dunklen Gassen New Yorks ab. Luise Tietjen, Kurts Tochter, muss nun die Geschäftsführung von »Tietjen & Söhne« übernehmen. Luise, gerade im Begriff, ihr Philosophie-Studium zu beenden, schlägt sich nun mit Gläubigern herum, mit Analysten und selbstgerechten Firmenteilhabern. Stets hat sie ihren Vater für seine Arroganz und sein Desinteresse verachtet, nun stürzt sie selbst kopfüber in die Hölle der Abhängigkeiten und nimmt Charakterzüge des Vaters an.
Nora Bossong erzählt die Geschichte des Unternehmens aus der Perspektive von Luise und ihrem Vater Kurt. Es ist ein mitreißender, ein meisterlicher Roman, den Nora Bossong geschrieben hat. Mit viel Schwung erzählt sie von gescheiterten Lebensentwürfen und Versagensängsten. Das Herbeisehnen der eigenen Kapitulation und die Verdeckung eigener Schwächen.
Doch ist »Gesellschaft mit beschränkter Haftung« auch die Geschichte von »Schlecker«, von »Neckermann«, der »Frankfurter Rundschau« und den anderen traditionsreichen (Familien-) Unternehmen, die dem rasanten Tempo und den Ansprüchen dieser Welt nicht standhalten konnten.
Dank Nora Bossongs Roman versteht man diesen Wahnsinn ein Stückchen besser.
Nora Bossong: »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«. Carl Hanser Verlag: München 2012.
»Es steht alles da«: Open-Mike-Preisträger lesen in Frankfurt

Nach der Kür kommt die Lesereise: Die vier Gewinner des diesjährigen »open mike«-Literaturpreises der Berliner Literaturwerkstatt kamen bereits einen Tag nach der Preisverleihung nach Frankfurt um ihre prämierten Texte vorzustellen. Entsprechend angespannt war die Stimmung im Orange Peel, gelegen zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem verlassenen Occupy-Camp am Willy-Brandt-Platz: Funktionieren die Texte auch außerhalb des Wettlesens? Und – um Himmels willen – was rückt da nach, an jungen, talentierten, spannenden, interessanten Literaten? Rückt da überhaupt was nach? Weiterlesen
Ein Bild von einer Stadt

Audrey Hepburn wäre die Idealbesetzung für die Rolle der Maeve Brennan. Das Leben der irisch-amerikanischen Schriftstellerin war tragisch und damit bestens für eine glanzvolle Hollywood-Produktion geeignet. Doch steht Audrey Hepburn für eine Verfilmung leider nicht mehr zur Verfügung und Maeve Brennan ist im kollektiven Gedächtnis fast vergessen. Zu Unrecht, natürlich.
Denn wer die Kolumnen von Brennan liest, die sie als Reporterin zwischen 1954 und 1981 für den »New Yorker« verfasste und kürzlich unter dem Titel »New York, New York« vom Göttinger Steidl Verlag in einer Neuübersetzung veröffentlicht wurden, der wird dem Charme und der Prägnanz der Kolumnistin verfallen.
Sie glaubt, dass kleine, preiswerte Restaurants die eigentlichen Herdfeuer der Stadt New York sind.
Maeve Brennan wurde 1917 in Dublin geboren, mittenhinein in die irische Diaspora. 1934 übersiedelte sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Washington, D.C. und begann schon bald für den »New Yorker« Kolumnen zu verfassen. Als »Talk of the town« fasst sie ihre Betrachtungen alltäglicher New Yorker Begebenheiten zusammen, in welchen die Kolumnistin von Menschen erzählt, die ihr bei Streifzügen durch die Metropole über den Weg laufen. Es sind kleine Geschichten, manche bizarr und skurril, andere anrührend und traurig, in denen sie Männer und Frauen porträtiert, das Leben auf der Straße, in Parks, Cafés, Hotels. In knappen Worten skizziert Brennan dabei ein unüberblickbares New York, zerrissen zwischen den zu diesen Zeiten herrschenden Rassenunruhen, einer gedeihenden Kriminalität und bitterer Verarmung.
Es ist ein baufälliger, von Bars und kleinen Restaurants gesäumter Straßenzug, und gestern Abend schwärmten Matrosen in weißen Uniformen wie Bienen um die Türen all der Bars…
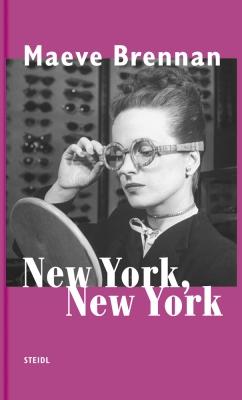 Brennan bemüht sich, innerhalb ihrer Kolumnen zumeist liebevoll und wohlwollend auf das Treiben der Bürger zu blicken. Doch steht auch sie allzu oft irritiert und mit großen Augen vor den Selbstentlarvungen ihrer Zeitgenossen.
Brennan bemüht sich, innerhalb ihrer Kolumnen zumeist liebevoll und wohlwollend auf das Treiben der Bürger zu blicken. Doch steht auch sie allzu oft irritiert und mit großen Augen vor den Selbstentlarvungen ihrer Zeitgenossen.
Die Kolumnen heißen »Der Mann, der sich die Haare kämmte«, »Ich schaue aus den Fenstern eines alten Hotels am Broadway« oder »Die neuen Mädchen in der 49. Straße West«. Detailliert werden da die Frisur und die Augen, der Gesichtsausdruck und Handbewegungen der Passanten beschrieben. Es sind feine Charakterstudien, mit wenigen Strichen gezeichnet. Polizisten werden durchleuchtet und Geschäftsmänner verfolgt. Maeve Brennan entgeht nichts. Dabei entsteht ein beeindruckendes zeithistorisches Portrait einer Stadt, die niemals zur Ruhe kommt. So wenig, wie ihre Protagonisten.
Wenn jeder in dieser Stadt zur Raison gebracht und in die richtige Richtung geschickt würde, wäre New York schon bald ein sehr ruhiger Ort.
Man blickt durch die Augen der Autorin auf ein längst vergessenes New York, man kommt dem Mythos dieser unfassbaren Stadt näher. So nahe, wie man ihr als Tourist niemals kommen könnte.
Wie vielschichtig und verzehrend diese Stadt ist, das fasst Brennan bereits im Vorwort dieser Zusammenstellung zusammen: »Selbst nach mehr als fünfundzwanzig Jahren hält sich die langatmige Lady noch immer nicht für eine »echte« New Yorkerin.« Ob das irgendwer irgendwann überhaupt sein kann?
Maeve Brennan: »New York, New York«. Aus dem amerikanischen Englisch von Hans-Christian Oeser. Steidl Verlag: Göttingen 2012.
»Ich gerate ungern in die Gefahr, redselig zu werden.«

Andreas Stichmann veröffentlichte im September 2012 seinen Debütroman „Das große Leuchten“, aus dem er beim Ingeborg-Bachmann-Preis 2012 ein Kapitel las. Der Roman erzählt von Rupert, der sich mit seinem Freund Robert auf einem irrwitzigen Roadtrip durch den Iran befindet, um seine verschwundene Freundin Ana zu finden. „Das große Leuchten“ ist eine rasante Erzählung und der beste Debütroman des Jahres.
Der Autor im Interview über Derwische, die Eleganz von Kurzgeschichten und das Schlachten von Hühnern.
Lieber Andreas Stichmann, was ist der Reiz des Reisens?
Man sammelt extrem viele Eindrücke und kommt aus seiner eigenen Welt heraus. Aber auch für den Schreibprozess ist das Reisen wichtig: Wenn man schon Figuren entwickelt hat, die man dann auf die Reise schickt, ist das oftmals sehr spannend. Von beiden Reisen kommt man mit einem weiteren Horizont zurück, als man losgefahren ist.
In Ihrem Debüt-Roman »Das große Leuchten« befinden sich Rupert und Robert, die Protagonisten der Erzählung, auf einer großen Reise durch ein für sie unbekanntes Land. Sie sind auf einer abenteuerlichen Suche. Kann der Mensch nur in der Fremde zu sich selbst finden?
Das ist zumindest das alte Morgenlandfahrt-Klischee, Reisen als Selbsterfahrung, das wohl in jeder Reisegeschichte mitläuft und hier ein bisschen gebrochen wird. Wenn man sich in unbekannten Situationen ganz neu verhalten muss, ist es natürlich schon so, dass man auch innerlich in Bewegung ist. Man erfährt sicherlich eher Neues von sich, wenn man mit einem bewaffneten Derwisch in der Wüste streitet, als wenn man alleine zuhause in der Küche sitzt. Gleichzeitig kam man sich aber nicht in die Wüste stellen und hoffen, dass jetzt etwas Erstaunliches passiert. Man kann auch eine Weltreise machen und immer der gleiche bleiben.
Sie selbst haben den Iran für einige Monate bereist. Hat es dort für Sie geleuchtet? Was ist »Das große Leuchten«?
In meinem Buch bezieht sich das Leuchten auf den Protagonisten Rupert, der sich als Kind im »Nicht-Blinzeln« übt. Er hält es bis zu zwei Minuten durch, die Dinge um ihn herum verschwimmen und beginnen zu leuchten, und dann meint er, hinter dem Leuchten die wahre Welt erkennen zu können, ein Muster hinter den Dingen zu erahnen. Das ist sein Ehrgeiz. Er will das große Leuchten hinter sich lassen. Irgendwie ist er aber auch selber ein Blender.
Sie haben mit »Jackie in Silber« im Jahre 2008 einen gefeierten Kurzgeschichten-Band veröffentlicht. »Das große Leuchten« ist Ihr erster Roman. Was war anders bei der Konzeption eines rund 200-Seiten umfassenden Romans im Vergleich zum Schreiben einer Kurzgeschichte?
Alles. Bei den Kurzgeschichten hatte ich immer den Fokus darauf, auf keinen Fall zu viel zu erzählen. Beim Roman kommt man nicht allzu weit, wenn man nur ganz knapp erzählt. Man muss sich etwas mehr gehen lassen können, das fällt mir nicht leicht, ich gerate ungern in die Gefahr, redselig zu werden.
Auch die Entwicklung der Figuren kann man nicht so präzise und knapp anlegen. Es dreht sich beim Roman nicht nur darum, mit ein paar Sätzen besonders viel über eine Person zu sagen, sondern auch darum, ihnen eine längere, kontinuierliche Entwicklung zu geben. Es muss dementsprechend alles viel langfristiger vorbereitet werden.
Das Ende von »Das große Leuchten« ist ungewöhnlich. Es ist offen und spielt mit Implikationen. Ist es Ihr liebstes Ende, oder würden Sie es mittlerweile gegen ein anderes eintauschen?
Ich hatte unterschiedliche Enden im Kopf, inzwischen erscheint mir das jetzige aber als das einzig mögliche. Es ist ja mehr so ein Dreh-und Angelpunkt als eine Endstation. Von dort aus wird die Geschichte im besten Fall vielleicht nochmal unterschiedlich beleuchtet.
Außerdem wollte ich unbedingt, dass Rupert an irgendeiner Stelle des Romans Hühner schlachtet – am Ende ist es jetzt also soweit. Er steigert sich richtiggehend in eine Hühnerschlacht-Meditation hinein.
Was kann die Kurzgeschichte, was der Roman nicht kann?
Kurzgeschichten können perfekter sein als Romane. Zum Beispiel »Jesus‘ son« von Denis Johnson ist so ein Beispiel. Da sitzt jedes Wort wie bei einem Gedicht. Bei einem Roman kann das zwar auch der Fall sein, aber bei vielen guten, dicken Romanen ist es dennoch so, dass man nicht unbedingt das Gefühl hat, dass jedes Wort ganz exakt so sitzen muss, damit die Geschichte funktioniert.
Kurzgeschichten können leichter und eleganter sein, weil sie mit weniger Strichen hingezeichnet werden.
 Ihre Kurzgeschichte »Warum schon wieder zu Watan?« erzählt die Geschichte eines traumatisierten Iraners, der in Deutschland Drogen verkauft. Seine Kunden interessieren sich nicht für seine Geschichte, die er ihnen immer wieder erzählt. Erleben Sie Ihre Generation als stumpf, hedonistisch, egomanisch?
Ihre Kurzgeschichte »Warum schon wieder zu Watan?« erzählt die Geschichte eines traumatisierten Iraners, der in Deutschland Drogen verkauft. Seine Kunden interessieren sich nicht für seine Geschichte, die er ihnen immer wieder erzählt. Erleben Sie Ihre Generation als stumpf, hedonistisch, egomanisch?
Nein, als Aussage ist mir das zu grob, ich kann das nicht pauschalisieren, man redet dann ja gleich über Massen von Menschen. Diese jungen Menschen hier sind ja auch zurecht genervt von der Geschichte des Iraners, denn sie haben sie schon tausendmal gehört. Das ist es ja grade, dass es ihnen grundsätzlich schon irgendwie nahe geht oder ging, und dass sie aber auch genervt sind, weil sie nicht wissen, was sie dazu sagen sollen.
In Ihren Geschichten liegen Tragik und Komik nah beieinander.
Durch Komik lassen sich viele Dinge leichter erzählen und ertragen. Für mich gehören aber auch Ironie und Romantik dazu, dass sind auch so Gegensätze, die für meine Begriffe gut zusammenwirken und die Dinge zusammen dreidimensionaler machen. Wenn eine Geschichte ganz eindimensional erzählt wird, berührt sie mich nicht. Dann ist sie nicht lebendig, dann ist immer schon von vornerein klar, wie das Ganze zu bewerten ist. Außerdem habe ich auch beim Lesen und Schreiben gerne mal etwas Spaß.
Welches Land werden Sie als nächstes bereisen?
Deutschland.
Andreas Stichmann wurde 1983 in Bonn geboren. „Das große Leuchten“ ist sein erster Roman. Im Jahre 2008 veröffentlichte Stichmann den gefeierten Kurzgeschichtenband „Jackie in Silber“, der elf Erzählungen bündelt. Die Kurzgeschichte „Warum schon wieder zu Watan“ kann man auf der Homepage des Schriftstellers herunterladen.
Nachlese: Der Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse 2012


Die Lehre der diesjährigen Buchmesse ist klar verständlich und erbauend: Jeder ist ein Autor, er muss nur mindestens im Internet einen Blog unterhalten. Wo einst das Sterben der Musikbranche feierlich ignoriert wurde, wird heuer der anstehende Tod des Buchhandels thematisiert: auf dem Frankfurter Messegelände. Die Verlage sind nervös, die Autoren gelassen. Mit Jussi Adler-Olsen im Geiste treffen wir uns zur Mittagszeit vor dem Bratwurststand und untermauern unsere eigenen Visionen mit »Pommes Rot-Weiß«.
Mit großen Augen irren wir durch den Bücherwald der Verlagsgruppe Random House. Eine blonde Medienfrau (die eigentlich gerade über einen Witz von Elke Heidenreich lachen wollte) klärt uns auf: »Die Verlagsgruppe Random House, Inc. inklusive der zugehörigen Dachmarke Random House befindet sich im Besitz der Bertelsmann AG und fungiert als Dachgesellschaft für alle Bertelsmann-Verlage.« Als ob wir das nicht schon von Wikipedia wissen würden. Das ausgestellte Programm dieses Verlags-Kolosses lässt uns ratlos zurück. Wir fragen uns, ob denn nicht schon viel zu viele Menschen »Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand« gekauft und womöglich auch gelesen haben. Zügig bahnen wir uns unseren Weg durch die Gassen. Auf den überfüllten Toiletten schütteln wir uns kräftig durch. Es wird besser, denn bald schon kommen wir am Stand unseres heimlichen Lieblingsverlages liebeskind an. Die Auswahl der Bücher ist herrlich. Die Gruppe einigt sich: Das gesamte Programm ist toll. Wir reißen uns schweren Herzens los. Wir haben Termine.

Zur Verabredung mit Andreas Stichmann treffen wir pünktlich am geschniegelten Rowohlt-Stand ein. Wir wollen über seinen gefeierten Debüt-Roman »Das große Leuchten« sprechen, haben aber ganz vergessen, dass Lothar Matthäus zeitgleich seine Autobiographie auf der Messe vorstellen will. Ein mittelschwerer Fauxpas, der uns bei der Messevorbereitung unterlaufen ist. Immerhin haben wir das Gelände nun für uns alleine: Die Polizisten sind beschäftigt, die Fotografen abgestellt und der Hof ist leer. In entspannter Atmosphäre plaudern wir mit Andreas Stichmann über die Vorzüge und Gefahren des Reisens. Wir beschwören unsere gemeinsame Bewunderung für Leif Randts »Schimmernder Dunst über CobyCounty« herauf und verabreden uns »auf bald!«

Kaum haben wir uns umgedreht, läuft uns die wunderbare, talentierte, anmutige Olga Grjasnowa über den Weg. Schnell ist ein Termin fürs ungezwungene Plaudern gefunden, abseits des großen Auflaufs. Noch bevor wir uns verabschieden, haben wir uns heimlich verliebt.
Während die Bestellung des ersten Bieres auf sich warten lässt, rattert Burkhard Spinnen an uns vorbei. Auf unseren flotten Anmachspruch von der Seite geht er nicht ein – er ist im Gespräch mit seiner Frau. Das Bier ist Essig. Wir trinken lieber Wein – und das am Abend in unserem Stammlokal im Frankfurter Nordend. Die trockene Luft in den Messehallen ist nicht jedermanns Geschmack.
»Ein gutes Programm zeichnet sich ab an seinen Ecken und Kanten.«

Hauke Hückstädt leitet seit Juli 2010 das Literaturhaus in Frankfurt am Main. Der Germanist absolvierte vor seinem Studium in Hannover und den Tätigkeiten als Lyriker, Herausgeber, Übersetzer und Literaturkritiker eine Lehre zum Tischler.
Als Programmleiter prägte Hückstädt von 2000 bis 2010 das Literarische Zentrum Göttingen und verhalf ihm zu bundesweiter Aufmerksamkeit.
Der Literaturvermittler im Interview über Robert Gernhardt, das Frankfurter Haifischbecken und den flüssigen Bestandteil der Literatur.
Lieber Hauke Hückstädt, ein Sprichwort besagt: »Viel Mundwerk, wenig Handwerk«. Warum haben Sie das Tischlern gegen die Literatur eingetauscht?
Es war kein Tausch. Literatur war schon vor diesen Lehrjahren in meinem Alltag. Ich habe Sachen gelernt, von denen ich auch fünfundzwanzig Jahre später noch etwas habe. Literatur und die Betriebsamkeiten um sie herum haben viel mit Handwerk zu tun. Wer das ignoriert, entspricht Ihrem Sprichwort.
Im Sommer 2010 haben Sie die Leitung des Frankfurter Literaturhauses übernommen. Eine der ersten von Ihnen arrangierten Lesungen war der Auftritt von Jonathan Franzen im ausverkauften Schauspielhaus. Es war ein Ausrufezeichen: Franzen hatte just seinen wellenschlagenden Roman »Freiheit« veröffentlicht und zierte das Cover des »Time«-Magazins. War das ein Auftakt nach Maß für Sie?
Zum eigentlichen Auftakt nach Maß wurde die tatsächlich allererste Lesung. Ich eröffnete meine Zeit hier ganz bewusst mit Judith Zander und ihrem Roman »Dinge, die wir heute sagten«. Dazu gab es im Vorfeld erst einmal nur freundliches Schweigen. Am Tag der Lesung war dann zufällig die Bekanntgabe der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2010. Judith Zander war nominiert. Das war für alle Beteiligten kein schlechtes Zeichen. Jonathan Franzen, Herta Müller, Margarethe Mitscherlich, das waren alles starke Autoren-Auftritte.
Nun leiten Sie seit rund zwei Jahren das Literaturhaus in Frankfurt. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?
Alles, was wir hier bewirken, bewirken wir für Publikum und um Öffentlichkeit für Literatur zu schaffen. Das Publikum wählt mit den Füßen. Und es hat uns bestätigt, in dem wir für unsere Art Programm zu machen über 30 Prozent Besucherzuwachs verzeichnen. Aber wir wollen, vor allem auch programmatisch, noch viel mehr. Das könnte erst der Anfang sein. Wir suchen immer Förderer, die bereit sind, neue Pfade zu schlagen.
Die traditionsreiche Frankfurter Literaturszene ist sagenumwoben. Hatten Sie keine Angst vor Vetternwirtschaft, Lobbyismus oder zu großen Fußstapfen, als Sie von Göttingen nach Frankfurt kamen?
Das mag es hier alles geben. Mir ist das aber nicht wesentlich. Leute wollen Vorteile, überall. Die Literatur ist eigentlich voll davon. Tatsächlich warnte mich eine Lady wortwörtlich vor dem Haifischbecken-Frankfurt. Das finde ich lustig, die allübliche Geschmeidigkeit und Raubeinigkeit und Missgunst so shark-mäßig aufzuwerten. Gernhardt hat Recht, die größten Kritiker der Elche, sind selber welche.
Just in dem Jahr, in welchem Sie die Leitung des Literaturhauses übernahmen, verließ der Suhrkamp Verlag Frankfurt und zog nach Berlin. Wie wichtig ist es für Ihre Arbeit, dass dennoch weiterhin so viele Verlage in Frankfurt beheimatet sind?
Wo ein Verlag seinen Sitz hat, ist heute nicht mehr ausschlaggebend. Stimmung und Klima sind wichtig. Die Atmosphäre in Frankfurt ist einzigartig. S. Fischer ist ein unheimlich starker Verlag mit guten Autoren und starken Köpfen im Hintergrund. Am Ende ist es die Mischung, die es nur hier gibt, das kaufmännische Blut, die Übersicht, die Vielfalt, die Buchhändler, die Verlage, der Börsenverein, Litprom, die Nationalbibliothek, das Goethehaus, die Tageszeitungen, der HR, die weltgrößte Buchmesse. Und daneben die Bereicherungen durch die anderen Institutionen wie MMK, Städel oder Filmmuseum.
Sie leiten Lesungen im Literaturhaus in der Regel mit Anekdoten über persönliche Berührungspunkte zwischen den Schriftstellern und Ihnen ein. Was ist der Zweck?
Oh, gut, dass Sie mir das sagen. Klingt nach Marotte. Ich werde mich prüfen. Was ich sagen kann, ist, dass ich wenigstens versuche, frank und frei und begründet zum Publikum zu sprechen. Ich empfinde das als angemessene, aufrichtige Form, wenn man Gäste hat.
Christian Kracht hat im Literaturhaus aus seinem Roman »Imperium« gelesen, dem Werk, in dem »Der Spiegel« eine »rassistische Weltsicht“ und „demokratiefeindliches Denken“ auszumachen glaubte. Es war eine Rufmord-Kampagne. Kracht hat viele seiner Lesungen in Deutschland daraufhin abgesagt. Warum kam er nach Frankfurt?
Weil ihm das wichtig war genauso wie uns. Und es war umso wichtiger, weil die Vorwürfe, die da erhoben und leider von so vielen bespiegelt wurden, viel demokratiefeindlicher und Weltsicht einschnürender waren als alles, wovon bei Kracht ohnehin nicht die Rede sein konnte. Eine einzige Dämlichkeit, die sich zudem eine Publikation aus dem Wehrhahn Verlag zurecht bog, den man sonst beim »Spiegel« keines Wimpernschlags für würdig gehalten hätte.

Häufig sind die Autoren der Saison im Literaturhaus zu Gast: Schriftsteller, die just Werke veröffentlicht haben, die durch das nationale Feuilleton getrieben werden – im aktuellen Herbstprogramm etwa Juli Zeh, Bodo Kirchhoff oder Richard Ford. Warum lesen Bestsellerautoren wie Nele Neuhaus oder Charlotte Link nicht im Literaturhaus?
Wenn man Programm macht, entscheidet man sich ganz zuerst einmal dafür, das Meiste nicht zu machen oder auch nicht machen zu können. Kirchhoff finde ich ungeheuer gut. Der will was. Zeh kann sehr faszinierend sein und ihr Buch ist wie eine Druckkammer. Und Richard Ford, wie könnte ich da nein sagen. Großes Kino. Ein gutes Programm zeichnet sich ab an seinen Ecken und Kanten. Ich hoffe, die finden sich immer wieder. Und leider finden unsere Formate wie »Backlist« oder »Werk-Tag«, die für ganz und gar unaktuelle Titel kämpfen, weniger Beachtung bei Presse wie Publikum.
Welche Rolle spielt Ihr persönlicher Geschmack bei der Zusammenstellung des Programms?
Er muss eine Hauptrolle spielen. Aber Sie brauchen ein weites Herz für viele Formen, Töne, Themen, Herangehensweisen.
Mögen Sie denn zwangsläufig die Bücher der Autoren, die bei Ihnen lesen?
Für manche gehe ich in die Knie, andere halte ich hoch, aus wieder anderen lernt man selbst im Widerspruch noch etwas. Sie müssen den Mut haben, sich ständig neuen Ansätzen und vielleicht auch Überforderungen auszusetzen.
Gibt es einen unerfüllten Wunsch?
Ja, mehr Zeit für Bücher und Genuss überhaupt.
Welcher Schriftsteller hat Ihre Einladungen bisher in den Wind geschlagen?
Keiner. Und wenn, ich wäre ihm oder ihr nicht böse, noch würde ich sie preisgeben. Es geht doch nicht um mich.
Das ans Literaturhaus angeschlossene Restaurant »Goldmund« hat eine große Auswahl hochprozentiger Spirituosen. Können Sie uns einen Schnaps empfehlen?
Das liegt außerhalb meiner Kompetenz. Das Trinken ist ein flüssiger Bestandteil der Literatur, es gehört aber auch zu den Berufsrisiken. Und ich finde, es wird genug Unfug geredet, unter Alkohol wird das nur noch schlimmer. Wenn aber, dann bitte russischen Wodka. Die Russen und Polen haben nicht nur die besten Dichter.
Hauke Hückstädt wurde 1969 in Schwedt geboren, seit 2010 leitet er das Literaturhaus in Frankfurt. Der Brandenburger hat zwei Lyrik-Bände veröffentlicht und war als Übersetzer, Herausgeber und Literaturkritiker tätig.

