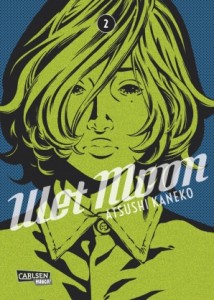 Sie hat nicht lange auf sich warten lassen, die Fortsetzung des Ende letzten Jahres erschienen Mangas »Wet Moon«: Atsushi Kaneko entführt die Leser wieder in die düsteren Welten Japans der 60er Jahre und erzählt die verworrene Geschichte rund um den von Amnesie geplagten Protagonisten Inspektor Sata, die japanische Mondmission und einen Korruptionsskandal innerhalb der Polizei weiter. Dabei ist es ebenso erfrischend wie traurig zu hören, dass die Reihe nicht als endlose Serie mit zig Bänden geplant ist, sondern vielmehr mit dem dritten Buch (Erscheinungstermin: 30.05.) enden wird.
Sie hat nicht lange auf sich warten lassen, die Fortsetzung des Ende letzten Jahres erschienen Mangas »Wet Moon«: Atsushi Kaneko entführt die Leser wieder in die düsteren Welten Japans der 60er Jahre und erzählt die verworrene Geschichte rund um den von Amnesie geplagten Protagonisten Inspektor Sata, die japanische Mondmission und einen Korruptionsskandal innerhalb der Polizei weiter. Dabei ist es ebenso erfrischend wie traurig zu hören, dass die Reihe nicht als endlose Serie mit zig Bänden geplant ist, sondern vielmehr mit dem dritten Buch (Erscheinungstermin: 30.05.) enden wird.
Schlagwort-Archive: Japan
»Der Stoff, aus dem Träume gemacht sind«
 Wenn der Carlsen Verlag mal gerade nicht versucht, graphische Liebhaberprojekte via Crowdfunding zu finanzieren, die dann leider mangels Beteiligung der Fanbase scheitern, wird stets daran gearbeitet, die Lücke zwischen der westlichen Graphic Novel und dem (fern)östlichem Manga zu schließen. Bereits im letzten Jahr gab es mit PIL ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Bemühungen zu bewundern, dieses Jahr wurde auf der Frankfurter Buchmesse nachgelegt: »Wet Moon« heißt der ebenso ambitionierte wie kunstfertige Band des in Deutschland bisher eher unbekannten Manga-Künstlers Atsushi Kaneko und bereits auf den ersten Seiten offenbart sich der Facettenreichtum des Werks: Der zu diesem Zeitpunkt noch namenlose Protagonist jagt in bester Noir-Manier einer Frau im roten Trenchcoat durch die engen Gassen eines japanischen Badeorts hinterher, bis er mit einem Mal die Hände vor das Gesicht schlägt und wie vom Donner gerührt stehen bleibt. Vor ihm hängt in gewaltiger Größe der Mond, der eine exakte Entsprechung des Mondes aus Georges Méliès‘ »Voyage dans la lune« ist, inklusive der Rakete, die in seinem linken Auge steckt.
Wenn der Carlsen Verlag mal gerade nicht versucht, graphische Liebhaberprojekte via Crowdfunding zu finanzieren, die dann leider mangels Beteiligung der Fanbase scheitern, wird stets daran gearbeitet, die Lücke zwischen der westlichen Graphic Novel und dem (fern)östlichem Manga zu schließen. Bereits im letzten Jahr gab es mit PIL ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Bemühungen zu bewundern, dieses Jahr wurde auf der Frankfurter Buchmesse nachgelegt: »Wet Moon« heißt der ebenso ambitionierte wie kunstfertige Band des in Deutschland bisher eher unbekannten Manga-Künstlers Atsushi Kaneko und bereits auf den ersten Seiten offenbart sich der Facettenreichtum des Werks: Der zu diesem Zeitpunkt noch namenlose Protagonist jagt in bester Noir-Manier einer Frau im roten Trenchcoat durch die engen Gassen eines japanischen Badeorts hinterher, bis er mit einem Mal die Hände vor das Gesicht schlägt und wie vom Donner gerührt stehen bleibt. Vor ihm hängt in gewaltiger Größe der Mond, der eine exakte Entsprechung des Mondes aus Georges Méliès‘ »Voyage dans la lune« ist, inklusive der Rakete, die in seinem linken Auge steckt.
„Two sides to every story“
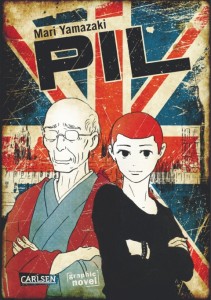 Er hat – obwohl millionenfach verkauft – eine schwierige Position im deutschen Buchmarkt, seine Thematik wird gleichermaßen extrem abgelehnt wie frenetisch verteidigt. Die Rede ist nicht etwa von Günther Grass, sondern vom Manga, eben jenem Genre, das seit ungefähr zwei Jahrzehnten auch in Deutschland einen kometenhaften Aufstieg erfuhr.
Er hat – obwohl millionenfach verkauft – eine schwierige Position im deutschen Buchmarkt, seine Thematik wird gleichermaßen extrem abgelehnt wie frenetisch verteidigt. Die Rede ist nicht etwa von Günther Grass, sondern vom Manga, eben jenem Genre, das seit ungefähr zwei Jahrzehnten auch in Deutschland einen kometenhaften Aufstieg erfuhr.
Obgleich der am stärksten wachsende Sektor des deutschen Buchmarktes wird den japanischen Comic-Büchern von Nicht-Otakus (Otaku: japanische Bezeichnung für Hardcore-Fans) immer noch kaum Beachtung geschenkt, von Meilensteinen wie „Barfuß durch Hiroshima“ oder „Akira“ einmal abgesehen. Auf der Gegenseite scheint sich die Hauptzielgruppe des Mangas auch weniger für andere Literatur oder sonstige Popkultur zu interessieren, ein Phänomen, das man jedes Jahr auf den Buchmessen beobachten kann. Immer wieder werden Versuche unternommen, die beiden Welten zu verbinden, nun erscheint im Carlsen-Verlag ein Buch, dass die Karten neu verteilen könnte. Weiterlesen
Die grundlose Traurigkeit, die der Anblick einer ländlichen Idylle im Herzen eines Menschen hervorruft
Wenngleich „Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki“ von Haruki Murakami eine recht kleine Geschichte erzählt, so erfasst sie doch ebenso präzise und berührend die Gefühlsregungen der menschlichen Psyche wie seine vorherigen Werke auch. Weiterlesen
Großwerden ist eine Tragödie
Yoko Ogawas Roman »Schwimmen mit Elefanten« erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der die Ästhetik des Schachspiels für sich entdeckt. Durch einen Zufall begegnet er seinem Sensei, seinem Meister: Ein ehemaliger Busfahrer von enormer Leibesfülle, der sich aus einem ausrangierten Bus ein Heim erschaffen hat, in dem er dem Jungen jeden Tag nach der Schule zum Schachspielen empfängt. Weiterlesen
Ich hab’s dir doch gesagt!
 Die Frage ist nicht, ob etwas passiert, sondern wann. Und was. Und wie schlimm es kommen wird. Blut wird fließen, soviel ist sicher. Aber werden Köpfe rollen, abgetrennte Gliedmaßen durch die Luft wirbeln und Gedärme aus offenen Bäuchen quellen? Oder kommt der Schrecken subtiler daher und zermartert den Verstand anstelle des Körpers? Aus Horrorfilmen oder Thrillern ist dieses Phänomen bekannt: Tumbe Trulla läuft durch den Wald, trifft einen schrägen Einheimischen und keine halbe Stunde später steckt ihr Kopf auf einem Pfahl. Oder so ähnlich. Als Zuschauer möchte man diesem dummen Ding am liebsten zurufen, nicht so naiv zu sein und dem finsteren, bärtigen Waldschrat doch besser nicht zu vertrauen. Aber sie steigt natürlich doch auf die Rückbank seines Autos und das Unglück nimmt seinen Anfang. Weiterlesen
Die Frage ist nicht, ob etwas passiert, sondern wann. Und was. Und wie schlimm es kommen wird. Blut wird fließen, soviel ist sicher. Aber werden Köpfe rollen, abgetrennte Gliedmaßen durch die Luft wirbeln und Gedärme aus offenen Bäuchen quellen? Oder kommt der Schrecken subtiler daher und zermartert den Verstand anstelle des Körpers? Aus Horrorfilmen oder Thrillern ist dieses Phänomen bekannt: Tumbe Trulla läuft durch den Wald, trifft einen schrägen Einheimischen und keine halbe Stunde später steckt ihr Kopf auf einem Pfahl. Oder so ähnlich. Als Zuschauer möchte man diesem dummen Ding am liebsten zurufen, nicht so naiv zu sein und dem finsteren, bärtigen Waldschrat doch besser nicht zu vertrauen. Aber sie steigt natürlich doch auf die Rückbank seines Autos und das Unglück nimmt seinen Anfang. Weiterlesen
»Sehr leise, aber doch auch recht laut.«
Zwei Männer sitzen auf einer Parkbank irgendwo in Japan. Zuerst beobachten sie einander, dann lernen sie sich kennen, schließlich wird der einen des anderen Rettung. Ganz verschieden sind sie doch beide Außenseiter, die sich von der Welt zurückgezogen haben, Verlierer, die nicht länger fähig sind in der Gesellschaft zu funktionieren. So erzählt »Ich nannte ihn Krawatte« nicht nur eine berührende Geschichte über eine ungewöhnliche Männerfreundschaft, sondern streift elegant und unaufgeregt auch von Anfang an die ganz fundamentalen Fragen des Menschseins. Ein kleiner Roman, aber eine große Sensation.
Milena Michiko Flašar beim Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse über Japan, private Rebellionen und den unverhofften Erfolg. Weiterlesen
»Wir treiben auf schmelzendem Eis«
Ein Park irgendwo in Japan als Schauplatz einer zaghaften Begegnung. Zunächst sind es noch zwei Bänke, auf denen die beiden Männer sitzen, jeder für sich allein. Von seiner Bank aus beobachtet der Erzähler, ein menschenscheuer junger Mann namens Taguchi Hiro, über Tage hinweg, wie ein alternder Büroangestellter Stunde um Stunde auf der gegenüberliegenden Bank verbringt, mit Zeitung lesen, Vögel füttern, Löcher in die Luft starren, schlafen. Jeden Tag, von Montag bis Freitag, sitzt er dort und vertreibt sich so die Zeit. Zwischendrin wird er von Tränen übermannt. Weil der Erzähler den Namen des Fremden aber anfangs nicht kennt, muss dessen charakteristisches Kleidungsstück, eine rotgrau gestreifte Krawatte, als Namensgeber herhalten. »Ich nannte ihn Krawatte« ist das dritte Buch der jungen österreichischen Autorin Milena Michiko Flašar und trotz der wenigen beschriebenen Seiten eine große Sensation.
Ich nannte ihn Krawatte.
Der Name gefiel ihm. Er brachte ihn zum Lachen.
Rotgraue Streifen an seiner Brust. So will ich ihn in Erinnerung behalten.
In poetischen Bildern und glasklar entrückter Sprache erzählt »Ich nannte ihn Krawatte« vom Schicksal der beiden Männer und wie sie sich näher kommen, kennen lernen, anfreunden. Ganz ohne Effekthascherei, dabei aber höchst effektiv, genügen wenige Worte um ein subtiles Gefühl der Melancholie zu evozieren, ja mithin schon ein Versprechen zu geben auf das, was da noch kommen wird: keine heitere Geschichte. Nicht nur, dass der Fremde von tiefer Trauer und Unglück gezeichnet scheint. Auch der bisherige Lebensweg des Erzählers gleicht einer kleinen, privaten Tragödie. Denn die letzten zwei Jahre verbrachte er allein und abgeschottet in seinem Zimmer im Haus der Eltern, ohne Kontakt zur Außenwelt. »Hikikomori« nennt man diese überwiegend jugendlichen oder jungen Exilanten, die für Monate oder gar Jahre die Flucht ins Allerprivateste antreten. In Japan ist das längst ein Massenphänomen, die Schätzungen reichen bis hin zu einer Million Betroffener, wobei die Dunkelziffer sehr hoch ist.
Mein Dasein bestand darin, dass ich fehlte. Ich war das Sitzkissen, auf dem keiner saß, der Platz am Tisch, der leer blieb, die angebissene Pflaume auf dem Teller, den ich zurück vor die Tür gestellt hatte.

Im Gespräch mit Krawatte legt Taguchi langsam seine Ängste ab, er tritt den schwierigen und langen Weg zurück in die Gesellschaft und in seine Familie an. Parallel erzählt er, wie es dazu kam, dass er eines Tages mit den Worten »Ich kann nicht mehr« in seinem Zimmer verschwand, das fortan für zwei Jahre zu seiner Höhle, seinem Zufluchtsort werden sollte. Es ist eine berührende Geschichte über die eigene Scham und den Verlust eines geliebten Menschen, welcher Krawatte aufmerksam folgt. Umgekehrt erzählt Krawatte aber auch von sich, dass er seine Arbeit verloren hat und sich nicht überwinden kann, es seiner Frau zu sagen. Stattdessen verlässt er weiterhin täglich zur gewohnten Zeit das Haus, doch anstatt ins Büro geht er in den Park. Scham und Angst, auch auf dieser Seite der Parkbank. Im Gefühl, den Ansprüchen nicht genügen zu können, sind der Hikikomori und Krawatte verbunden, und eben diese Verbundenheit gibt ihnen Halt.
Wir sagen beide dabei zu, wie uns alles entglitt, und fühlten beide eine heimliche Erleichterung darüber, nicht in der Lage zu sein, die Dinge gerade zu biegen. Vielleicht war das der Grund, warum wir aufeinandergetroffen waren.
Die große Stärke des Romans besteht zweifellos darin, dass er ohne jede Sentimentalität von zwei Existenzen erzählt, die im Jargon der so genannten Leistungsgesellschaft als »gescheitert« gelten dürften. Er erweckt kein Mitleid, aber er gibt Hoffnung. Was geschehen ist, lässt sich nicht rückgängig machen, aber die Erinnerung, die im gegenseitigen Erzählen festgehalten ist, spendet immerhin Trost. Eingeschlossen in Melancholie und Traurigkeit zeugt »Ich nannte ihn Krawatte« so vom Willen, trotz aller Widrigkeiten und Rückschläge weiterzumachen, und verbreitet einen zarten Hauch von Optimismus. »Wir wollen das Leben nicht, aber es muss gelebt werden«, heißt es bei einem anderen großen Österreicher. Flašars Figuren sind am Ende einen Schritt weiter, auch wenn sie nur eines gelernt haben: »Dass es sich lohnt, am Leben zu sein«.
Milena Michiko Flašar (geb. 1980) studierte Komparatistik, Germanistik und Romanistik in Wien und Berlin. Die Tochter eines Österreichers und einer Japanerin lebt heute als Schriftstellerin in Wien und unterrichtet nebenbei Deutsch als Fremdsprache. »Ich nannte ihn Krawatte« war auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2012.
Milena Michiko Flašar: »Ich nannte ihn Krawatte«. Wagenbach: Berlin 2012.
