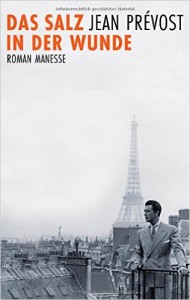 Der französische Autor Jean Prévost starb zwei Tode, wenn man seinem Biographen Jérôme Garcin glauben darf. Den ersten starb er durch die Deutschen, die ihn 1944 als Partisan in der Nähe von Grenoble erschossen. Die zweite Ermordung erfolgte durch die Französische Leserschaft, die den gefeierten Vorkriegsliteraten nach Ende des Zweiten Weltkriegs einfach vergaß, mit einer grausam systematischen Gleichgültigkeit. Zumindest aus dem zweiten Grab hebt man den Vergessenen nun wieder heraus, wobei jedoch die Frage besteht, ob es sich lohnt, Jean Prévost wiederzubeleben, dessen einzige weltliterarische Spur einzig Hemingway zu sein scheint, der sich beim Boxen einen Daumen am harten Schädel des Franzosen brach.
Der französische Autor Jean Prévost starb zwei Tode, wenn man seinem Biographen Jérôme Garcin glauben darf. Den ersten starb er durch die Deutschen, die ihn 1944 als Partisan in der Nähe von Grenoble erschossen. Die zweite Ermordung erfolgte durch die Französische Leserschaft, die den gefeierten Vorkriegsliteraten nach Ende des Zweiten Weltkriegs einfach vergaß, mit einer grausam systematischen Gleichgültigkeit. Zumindest aus dem zweiten Grab hebt man den Vergessenen nun wieder heraus, wobei jedoch die Frage besteht, ob es sich lohnt, Jean Prévost wiederzubeleben, dessen einzige weltliterarische Spur einzig Hemingway zu sein scheint, der sich beim Boxen einen Daumen am harten Schädel des Franzosen brach.
„Das Salz in der Wunde“ erzählt die Geschichte des Pariser Jurastudenten Dieudonné Crouzon, der im Frankreich der 20er Jahre ein recht beschauliches Leben zwischen Doktorarbeit und Nebenjobs führt, bis ihn ein unvorhergesehenes Ereignis völlig aus der Bahn wirft. Dousset, ein langjähriger Freund, bezichtigt (wie sich später herausstellen sollte, irrtümlicherweise) des Diebstahls, es kommt zum Streit und Dieudonné schlägt sein Gegenüber nieder. Zwar taucht die fragliche Brieftasche kurz darauf wieder auf, doch die Kluft ist bereits geschlagen: Dousset erzählt die Geschichte des Diebstahls und des tätlichen Angriffs am nächsten Tag dem gesamten Freundeskreis, wodurch Crouzon, der direkt die Verteidigerposition einnehmen muss, keine Möglichkeit mehr bleibt, seinen Namen reinzuwaschen. Ein immer wiederkehrendes Motiv des Romans, das im Anfang seine stärkste Ausprägung erfährt, ist die Frage der Herkunft.
Diedonné Crouzon ist – im Gegensatz zu den meisten seiner Zeitgenossen – ein intelligenter und (beinahe zu) scharfsinniger Charakter, doch er stammt nicht aus einer wohlhabenden oder einflussreichen Familie, während seine Freunde alle die Kinder von Politikern und Industriellen sind. Genau dieses „Salz in der Wunde“ ist es, das ihn antreibt, und welches ihn verbissener und energischer arbeiten lässt als jeden anderen. In besagtem Augenblick, als alle Freunde die Geschichte des Diebstahls glauben, bleibt ihm jedoch nur der Rückzug. Auf Anraten eines guten Freunds zieht Crouzon in die Kleinstadt Châteauroux, um dort als Redakteur für eine Wahlzeitung zu arbeiten, bis sich die Wogen in Paris geglättet haben. Dass er erst Jahrzehnte später zurückkehren wird, um seinen Freunden zu zeigen, dass seine Wunden immer noch nicht verheilt sind, ahnt zu diesem Zeitpunkt keiner der Beteiligten.
Prévosts Werk liegt eine Schärfe inne, die tatsächlich an den stechenden Schmerz einer schlecht heilenden Wunde erinnert und sich auf mehrere Ebenen des Romans ausstreckt. Zum einen fällt natürlich der schwermütige Charakter des Protagonisten Crouzon auf, den die Welt oft genug anekelt, der aber dennoch immer weiterkämpft, ohne ideologische Motivation, ohne Freude an Erfolgen, ohne Pathos. Zu seinen Mitmenschen oftmals kalt und abweisend, scheint der junge Mann sofort zu zerbrechen, wenn er mit dem Leser allein ist – nur um sich im nächsten Moment wieder aufzuraffen.
Eine zweite Schärfe liegt wie eine Klinge in der Sprache versteckt, welcher sich der Autor bedient, um die erzählte Welt mit der Kunstfertigkeit eines Chirurgen zu sezieren und auszubreiten.
Châteauroux, diese Stadt, in der die meisten Häuser, aus dem Weichgestein unterirdischer Steinbrüche erbaut, im Erdgeschoss verharren oder höchstens ein Stockwerk hoch emporragen, kam ihm erstaunlich weitläufig, flach und staubig vor. Dabei hatte es am Morgen doch geregnet, was den Landschaften einen blauen Schimmer verlieh.
An dieser Stelle ist auch die deutsche Übersetzung zu loben, die nicht nur den Transit zwischen Französisch und Deutsch ohne Probleme bewerkstelligt, sondern den zuweilen sehr eigenen Stil Prévosts beibehält und in einem umfangreichen Appendix über die teilweise sehr speziellen Ausdrücke und Sachverhalte Auskunft gibt.
Die dritte und letzte Ausprägung der literarischen Schärfe von „Das Salz in der Wunde“ schließlich ist eine dokumentarische Genauigkeit, mit der die politische und gesellschaftliche Stimmung im Frankreich der 20er Jahre eingefangen wird. Und gerade hier wird es für nicht-französische Leser interessant, ist die französische Perspektive auf diese Jahre doch eine recht ungewöhnliche, die in der Literatur bisher nicht so viel Anklang fand wie beispielsweise die deutsche, russische oder amerikanische.
Und falls es an diesem Punkt noch nicht klar sein sollte: Ja, Jean Prévost hat die Wiederbelebung (die hierzulande eigentlich mehr eine Genesis ist, denn „Das Salz in der Wunde“ erscheint erstmals in deutscher Sprache) mehr als verdient. Dass der französische Autor vergessen wurde, mag viele Gründe haben, doch der von Joseph Hanimann im Nachwort genannte scheint mit der plausibelste zu sein: Ebenso wie Charlie Chaplin, Ernst Toller und einige andere war Jean Prévost ein Mensch, der zum einen vielfältig talentiert war, zum anderen aber stets eine differenzierte Position einnahm und sich nicht vor den Karren einer politischen Agenda spannen ließ.
So plädierte er, bevor er der Résistance beitrat, jahrelang für eine deutsch-französische Annäherung, und ein Aufheben der Sanktionen, die das Deutsche Reich nach dem Ersten Weltkrieg auferlegt bekommen hatte. Genau wie Chaplin und Toller wurde er dafür von beiden Lagern angefeindet und es wurde der Versuch unternommen, die Werke Prévosts ebenso vergessen und unbekannt zu begraben wie seinen Leichnam. Dass dieses Vorhaben nun – wenn auch spät – vereitelt wird, ist wirklich ein Segen. Und Salz in den Wunden der Konformisten.
Jean Prévost: Das Salz in der Wunde. Manesse: München 2015.
