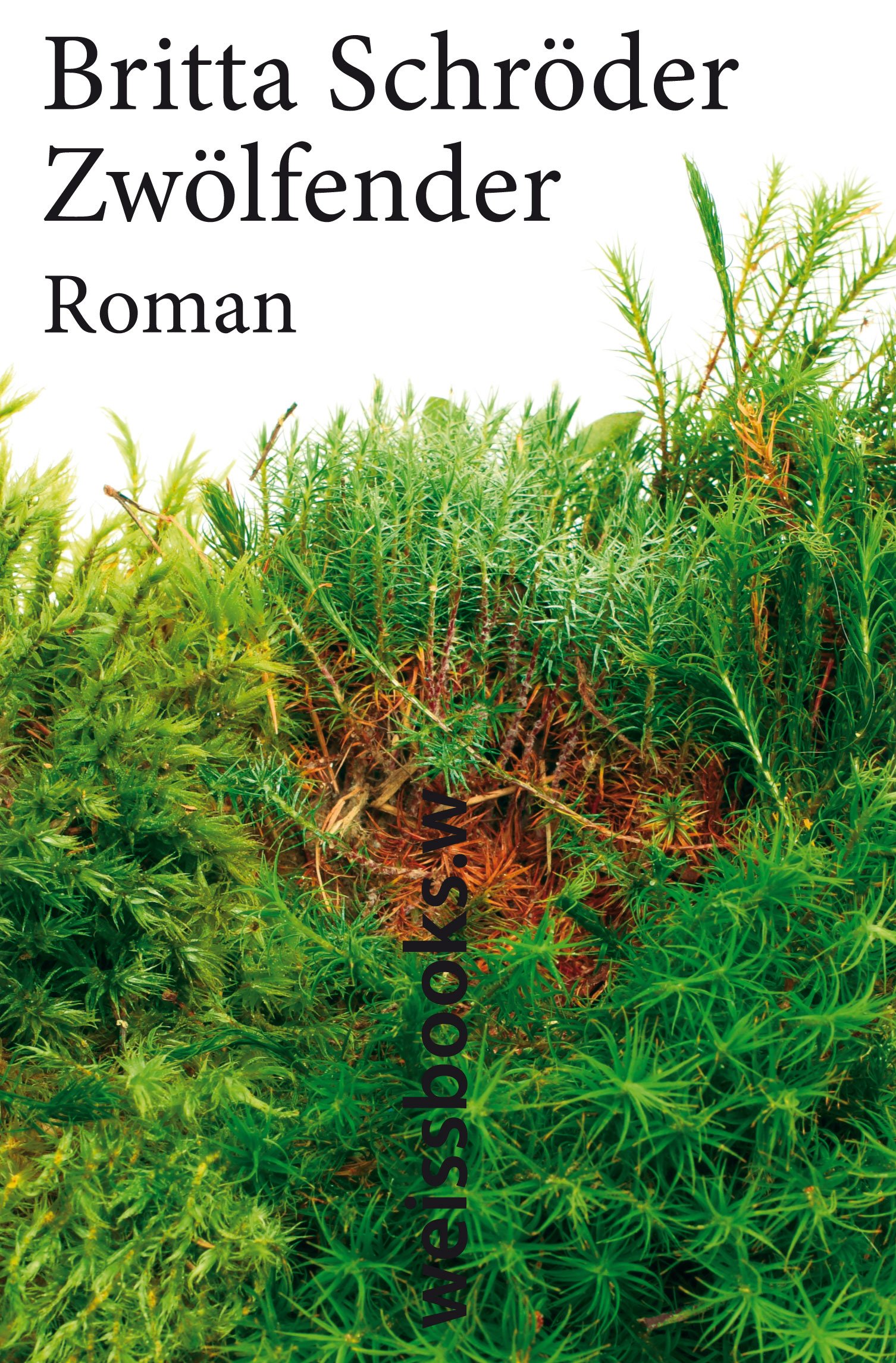 Die namenlose junge Frau, um die es in »Zwölfender« geht, bewegt sich ab der ersten Seite des Romans in einem Raum zwischen Gewissheit und Zweifel. Sie befindet sich in einer Zwischenwelt, die typographisch abgesetzt erscheint, in feinerer, minimalistischer Schrift und unregelmäßig, wie Lücken zwischen den realer anmutenden Kapiteln. Hier lebt sie in einem Wald, in einer selbsterwählten Isolation von ihrer Umwelt, aus der sie keinen Rückweg mehr findet. Sie schläft auf Steinen, neben Füchsen und Luchsen, baut sich zu Anfang ein Zelt aus Farn und Ästen, gewöhnt sich rasch an die Geräusche der Natur und weiß schließlich nicht mehr, vor was sie ihr Unterschlupf überhaupt beschützen sollte. Sie wird eins mit dem Wald und nur entfernt hört sie Fluglärm, der sie wissen lässt, dass sich die Welt außerhalb noch weiterdreht.
Die namenlose junge Frau, um die es in »Zwölfender« geht, bewegt sich ab der ersten Seite des Romans in einem Raum zwischen Gewissheit und Zweifel. Sie befindet sich in einer Zwischenwelt, die typographisch abgesetzt erscheint, in feinerer, minimalistischer Schrift und unregelmäßig, wie Lücken zwischen den realer anmutenden Kapiteln. Hier lebt sie in einem Wald, in einer selbsterwählten Isolation von ihrer Umwelt, aus der sie keinen Rückweg mehr findet. Sie schläft auf Steinen, neben Füchsen und Luchsen, baut sich zu Anfang ein Zelt aus Farn und Ästen, gewöhnt sich rasch an die Geräusche der Natur und weiß schließlich nicht mehr, vor was sie ihr Unterschlupf überhaupt beschützen sollte. Sie wird eins mit dem Wald und nur entfernt hört sie Fluglärm, der sie wissen lässt, dass sich die Welt außerhalb noch weiterdreht.
Dieser Ort und seine Bedeutung bleiben bis zuletzt rätselhaft und diffus. Dennoch erfährt der Leser hier mehr als irgendwo sonst im Roman über die Person der jungen Frau. In Teilstücken, Erinnerungen und anderen Fragmenten zeigt sich ihre eigene Distanziertheit von sich selbst. Bereits sehr lange scheint sie auf der Suche nach sich zu sein. Schon als Jugendliche hatte sie den Kontakt zu sich nicht mehr finden können. Damals unternahm sie den Versuch aus einem Betonblock ein Portrait von sich anzufertigen. Sie meißelte, bis sie eine schemenhafte Figur erkannte, umkreiste die Figur ein ums andre Mal, doch sah in ihr kein Ich. Sie scheiterte.
Es war wohl mein letzter Versuch, selbst eine Form zu finden.
So unklar die Person der jungen Frau auch bleibt, so genau lernt der Leser ihre Hände kennen. Hier bündelt sich ihre Essenz, das, was sie ist. Sie ist Restauratorin, arbeitet also weiterhin handwerklich und spricht schon auf den ersten Seiten fast liebevoll von der unterschiedlichen Beschaffenheit der Materialien. Das Gefühl ein Holzscheit in der Hand zu halten, gibt ihr Gewissheit. Gips wird beim Anrühren warm, als hätte sie ein Leben erschaffen. Und Blattgold, auch noch so zart, verbietet jedem Gegenstand weiter zu atmen.
Sie hat die Welt stets greifend begriffen und so wird die Charakterisierung ihrer Person über eine eingehende Beschreibung ihrer Hände verständlich. Sie sind nicht eben schön, sondern sehnig und eher funktional. Die Linke ist jedoch etwas zartgliedriger, weshalb sie in Gesellschaft vorzugsweise mit der linken Hand raucht. Mit der Rechten hingegen greift sie zu. Mit ihr dringt sie zum Wesen der Dinge vor.
Es sind nüchterne Hände. Sie greifen zu, als gäbe es keinen Zweifel. Meine Rechte wäre fähig, meine Linke zu brechen. Und umgekehrt.
In der Welt jenseits des Waldes begibt sie sich auf eine Reise, mit der sie die Suche nach sich selbst wieder aufzunehmen scheint. Weshalb sie loszieht, erklärt sie nur undeutlich und es steht im Widerspruch zur augenscheinlichen Selbstfindung: Sie wolle sich vergessen. »Erst erinnern, dann vergessen.« Sie bricht auf kurz nachdem sie ihrem Vater nach offenbar langer Zeit des Schweigens einen Besuch abstattet. Sie bemüht sich, sich in ihm selbst zu sehen. Und unvermittelt sticht sie ihm ein Küchenmesser in den Körper. In diesem Moment erkennt sie in seinem ausdruckslosen Blick, dass hinter seiner Fassade aus Neugierde und Abenteuerlust ein Mensch stand, der des Lebens müde war. Diese Erkenntnis, der Verlust des Erbes von Lebensfreude, löst einen Umbruch aus.
Ebenso unvermittelt bucht sie zwei Tage darauf einen Flug nach Florida und schläft dort tagelang am Strand. Im Sand findet sie etwas, das zu ihr gehört. Kurze Zeit später fliegt sie nach Santiago de Chile. Zunächst scheint dieses Umherirren ziellos und willkürlich, doch sie folgt dabei der Landkarte ihrer Hand, die sie in der Zwischenwelt beschreibt: Ihrem Unterarm entspringt eine Ader, die sich kurz über der Handwurzel in zwei Ströme teilt. Der eine fließt in den Atlantik, der andere mündet in den Pazifik und verödet in der Wüste Chiles.
Ich suche mir diese Bilder nicht aus. Sie sind in meinem Kopf.
Auf ihrem Weg begegnet sie sich selbst in der Person einiger Weggefährten. So wäre sie dem anpassungsfähigen Robert gerne ähnlicher, dem zänkischen Betrüger Merce ist sie ein wenig ähnlicher als ihr lieb ist. Und so setzt sich ihre Reise fort. Auch wenn eine oberflächliche Bewegung durch die Ortswechsel entsteht, liegt in jedem ihrer nüchternen und klaren Worte wie auf zweiter Ebene eine tiefe Traurigkeit, die Leser und Protagonistin gleichermaßen zu lähmen scheint. Einzig die Melancholie trägt sie durch die Geschichte.
Die einfachen und doch seltsam bedrückende Worte lassen den Leser zugleich ratlos und verständnisvoll zurück. So vertraut die Koordinaten der Geschichte am Ende auch sind, so bleibt es eine vertraute Welt des Ungewissen. Ein tatsächlich faszinierender Debütroman, der beginnt, wo er aufhört, und umgekehrt. In den Worten der Protagonistin: »Was früher Zweifel war, ist jetzt Gewissheit – und andersherum… Und nun gehe ich die Strecke dazwischen ab.«
Britta Schröder: »Zwölfender«. weissbooks.W.: Frankfurt am Main 2012.
