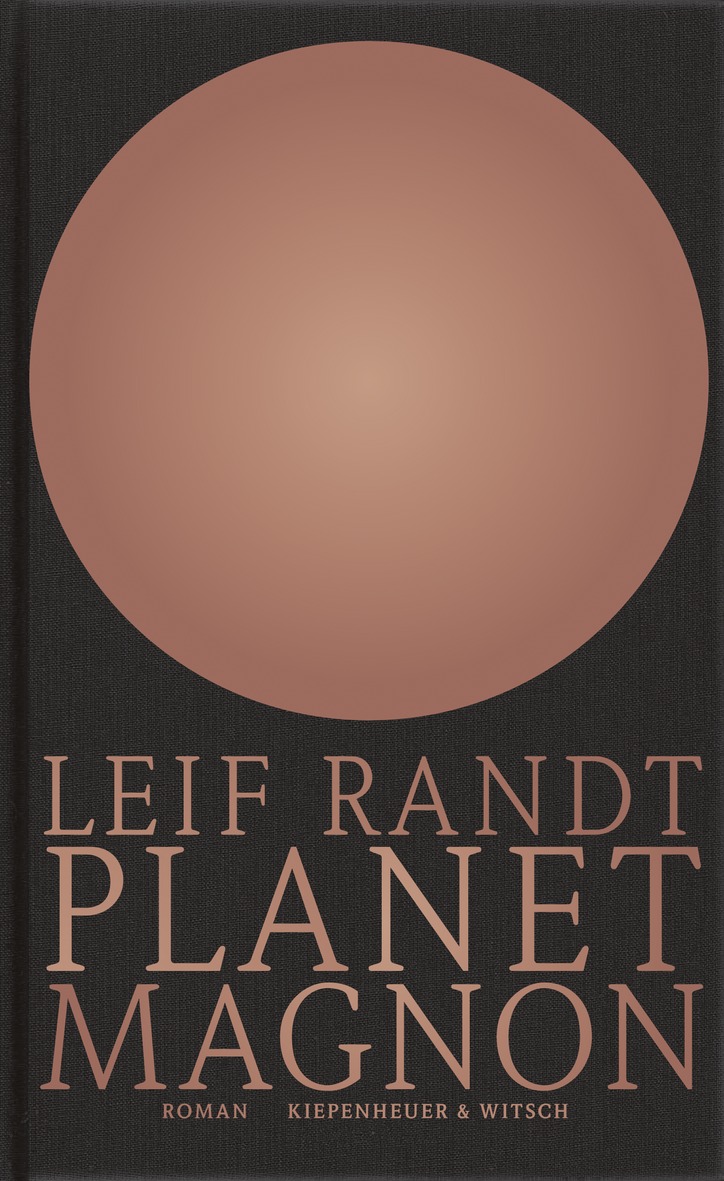 Wir leben in wirren Zeiten. Die Welt scheint nur noch aus Konflikten zu bestehen, unsere Telefone werden abgehört und dieser eine bestimmte Freund hört nicht auf, uns Spieleanfragen auf Facebook zu schicken. Hinter uns liegt eine Vergangenheit, zur der wir uns nicht mehr zugehörig fühlen, vor uns eine Zukunft, die wir nicht kennen. Aber zumindest bei letzterem kann Abhilfe geschaffen werden, mit jenem Genre, das bereits seit Jules Verne die Ungewissheit der kommenden Jahre als Nährboden nutzt: Die Science Fiktion. Was liegt also näher, als die Welt erst einmal Welt sein zu lassen, die Füße hochzulegen und einen der neueren Vertreter jenen Genres in die Hand zu nehmen? „Planet Magnon“ ist ein solcher, ein kurzer Blick auf den Verfasser sorgt allerdings für Erstaunen: Der junge Autor Leif Randt sorgte in den letzten Jahren durchaus für einiges Aufsehen, als Schreiber von Science Fiction ist er (bisher) jedoch noch nicht in Erscheinung getreten. Vielmehr gelang es seinem Erstling „Leuchtspielhaus“ (2010) und dem im Folgejahr erschienenem „Schimmernder Dunst über CobyCounty“, ein differenziertes, fragiles Bild der heutigen Jugend- und Popkultur aufzuzeichnen, ein Zeitzeugnis einer bereits abgefeierten Epoche. Insofern wirkt es auf den ersten Blick befremdlich, wenn die jüngste Publikation Randts auf einmal im Gewand eines fiktiven Zukunftsentwurf daherkommt, doch auch hier lassen sich Reminiszenzen des in den früheren Werken auftauchenden Diskurses entdecken. „Planet Magnon“ lässt sich also als eine Art Hybrid verstehen, das die „Coming of Age“-Thematik mit dem Szenario eines Science-Fiktion-Romans verknüpft. Dabei klappt eines wesentlich besser als das andere.
Wir leben in wirren Zeiten. Die Welt scheint nur noch aus Konflikten zu bestehen, unsere Telefone werden abgehört und dieser eine bestimmte Freund hört nicht auf, uns Spieleanfragen auf Facebook zu schicken. Hinter uns liegt eine Vergangenheit, zur der wir uns nicht mehr zugehörig fühlen, vor uns eine Zukunft, die wir nicht kennen. Aber zumindest bei letzterem kann Abhilfe geschaffen werden, mit jenem Genre, das bereits seit Jules Verne die Ungewissheit der kommenden Jahre als Nährboden nutzt: Die Science Fiktion. Was liegt also näher, als die Welt erst einmal Welt sein zu lassen, die Füße hochzulegen und einen der neueren Vertreter jenen Genres in die Hand zu nehmen? „Planet Magnon“ ist ein solcher, ein kurzer Blick auf den Verfasser sorgt allerdings für Erstaunen: Der junge Autor Leif Randt sorgte in den letzten Jahren durchaus für einiges Aufsehen, als Schreiber von Science Fiction ist er (bisher) jedoch noch nicht in Erscheinung getreten. Vielmehr gelang es seinem Erstling „Leuchtspielhaus“ (2010) und dem im Folgejahr erschienenem „Schimmernder Dunst über CobyCounty“, ein differenziertes, fragiles Bild der heutigen Jugend- und Popkultur aufzuzeichnen, ein Zeitzeugnis einer bereits abgefeierten Epoche. Insofern wirkt es auf den ersten Blick befremdlich, wenn die jüngste Publikation Randts auf einmal im Gewand eines fiktiven Zukunftsentwurf daherkommt, doch auch hier lassen sich Reminiszenzen des in den früheren Werken auftauchenden Diskurses entdecken. „Planet Magnon“ lässt sich also als eine Art Hybrid verstehen, das die „Coming of Age“-Thematik mit dem Szenario eines Science-Fiktion-Romans verknüpft. Dabei klappt eines wesentlich besser als das andere.
Was niemanden überraschen sollte: Die klassische Leif-Randt-Portion des Romans ist durchaus sehr gelungen, man folgt dem jungen Marten Elliot durch ein halb utopisches, halb dystopisches Universum, in dem Planeten nach Videospiel-Konsolen und –Charakteren benannt sind („Sega“, „Toadstool“ und „Zelda“), in dem es keine Konflikte mehr gibt, weil ein allwissendes Computersystem mit dem verheißungsvollen Namen „Actual Sanity“ alles überwacht, und in dem anstelle von Nationen sogenannte Kollektive existieren. Soweit, so gewohnt. Und hier liegt genau das Problem, was die übrige Gestaltung von „Planet Magnon“ angeht: Als halbwegs im Genre bewanderter Leser hat man auf jeder zweiten Seite das Gefühl, als habe man das schon irgendwo einmal gelesen oder gesehen. Ein Computersystem, das autonom handelt und (vorerst) zum Wohle der Menschheit handelt? Klingt nach HAL9000 aus Arthur C. Clarkes „2001“ oder Skynet aus den „Terminator“-Filmen. Die Aufspaltung der Gesellschaft in Kollektive? Klingt nach „Brave new World“ von Huxley oder „Der futurologische Kongreß“ von Lem. Natürlich gibt es zahlreiche neue Elemente, die in den Handlungsverlauf eingestreut werden, aber es fällt schwer, den durchaus vorhandenen Ideenreichtum zu genießen, wenn sich der gesamte Entwurf wie ein abgepaustes Bild anfühlt.
Nun wäre es aber ungerecht, dem Autor an dieser Stelle eine solche Tätigkeit vorzuwerfen, denn es besteht gleichermaßen die Möglichkeit eines ironischen Zitates. Dies wäre die angenehmere – und im Fall Leif Randts vermutlich auch wahrscheinlichere – Erklärung der zahlreichen auftauchenden bekannten Phänomene. Das einzige Problem bei dieser Interpretation ist, dass sich „Planet Magnon“ als Science-Fiction-Roman selbst sehr ernst zu nehmen scheint. So findet sich am Ende des Werks ein beinahe 30 Seiten starker Glossar, der bemüht ist, jede Errungenschaft der Zukunft genau zu entschlüsseln, der aber gleichzeitig zum Scheitern verurteilt ist, da sich der Leser gar nicht erst in die fiktive Welt herein finden kann. Diese wird durch den sprachlichen Stil, die Figuren und das Fehlen des eigentlichen Konflikts erfolgreich dekonstruiert – sehr zum Vorteil der „Coming of Age“-Seite der Erzählung. Die Aussage, welche nach dem seicht verebbenden Ende des Romans zu stehen scheint, ist, dass es immer problematisch sein wird, ein junger Mensch zu sein. Egal, ob man mit Raumshuttles durch die Gegend fliegen kann, oder nicht. Leider verbirgt sich diese einfache Schlussfolgerung hinter so viel unnötigen Schilderungen einer diegetischen Welt, die in ihrer bloßen Existenz schon wie ein Klischee wirkt, so dass es nahezu unmöglich scheint, sie zu entziffern. Dass man dennoch in der Lage ist, sie zu entdecken, liegt einzig an der unvergleichlichen Art Leif Randts, die Figuren seiner Welt aneinander vorbei manövriert, wodurch sie halt- und antriebslos herumtreiben, wie besatzungslose Frachter auf dem offenen Meer.
Ist „Planet Magnon“ also der Leserschaft ans Herz zu legen? Es ist zweifelsfrei viel Hingabe und Liebe in die Herstellung und Gestaltung geflossen, das erkennt man bereits an dem edlen Erscheinungsbild und der Bemühung, den erzählten Kosmos aufzuschlüsseln. Was den Inhalt angeht, so muss sich der potentielle Leser vor dem Kauf die Frage stellen, was er erwartet. Als Science-Fiction-Roman fällt „Planet Magnon“ leider durch, weniger wegen der eigenen Unzulänglichkeit, sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil auf diesem Gebiet wesentlich genauere, distinguierte und spannendere Vertreter der Gattung existieren, mit denen sich jede Neuerscheinung zwangsläufig messen lassen muss.
Falls man jedoch nicht nach Science Fiction sucht, sondern nach einem neuen Roman von Leif Randt, so wird man keinesfalls enttäuscht, „Planet Magnon“ steht in würdiger Tradition zu Randts früheren Publikationen und beweist obendrein noch beiläufig etwas – vielleicht eine der wichtigsten Betrachtungen der gegenwärtigen Kulturkritik – dass nämlich das Gefühl der Entwurzelung zeitlos ist.
Leif Randt: Planet Magnon. Kiepenheuer & Witsch: Köln 2015.
