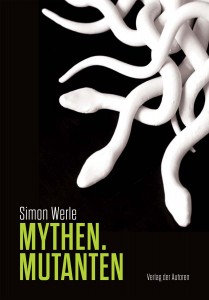 In »Mythen. Mutanten.« kreiert Simon Werle acht Stücke im antiken Kontext. Sie sind dynamische Lückenfüller, übersetzt in eine moderne Sprachpoetik mit tragischer Substanz. Vergangenen Herbst ist die Sammlung im Verlag der Autoren erschienen. Laut dem Kulturtheoretiker und Ägyptologen Jan Assmann sind Mythen kulturelle Muster, an denen die Menschen ihr Handeln orientieren und in deren Licht sie die Welt verstehen. Sie sind unser kulturelles Erbe, die mythologische Imagination ist über Generationen eine Inspirationsquelle − nicht nur für Künstler und Künstlerinnen, Philosophen und Philosophinnen, Psychologen und Psychologinnen.
In »Mythen. Mutanten.« kreiert Simon Werle acht Stücke im antiken Kontext. Sie sind dynamische Lückenfüller, übersetzt in eine moderne Sprachpoetik mit tragischer Substanz. Vergangenen Herbst ist die Sammlung im Verlag der Autoren erschienen. Laut dem Kulturtheoretiker und Ägyptologen Jan Assmann sind Mythen kulturelle Muster, an denen die Menschen ihr Handeln orientieren und in deren Licht sie die Welt verstehen. Sie sind unser kulturelles Erbe, die mythologische Imagination ist über Generationen eine Inspirationsquelle − nicht nur für Künstler und Künstlerinnen, Philosophen und Philosophinnen, Psychologen und Psychologinnen.
Ob nun Freud durch den Ödipus-Komplex das 20. Jahrhundert prägt, die Feministin und Philosophin Judith Butler anhand der Antigone Geschlechterrollen hinterfragt oder Werle ihnen neue Schicksale verpasst, eines ist klar: Die mythologischen Figuren haben den Transfer überlebt, sie verstauben nicht als vergessene Erzählungen, sondern finden in Film, Theater und eben in der Literatur ihre variantenreiche Wiederbelebung, ihre Mutation.
Dabei verarbeitet Werle bekannte Figuren wie Ödipus, Antigone, Ismene, Medea, Jason, Theseus und Hippolytos, erfindet aber auch neue Gestalten wie die Totenwäscherin Kore oder Kampaspe, eine brennende Stadt verkörpert in einer weiblichen Gestalt. Allerdings ist Medea hier nicht unbedingt die kaltblütige Kindesmörderin, sondern sie entlässt vielmehr ihre Kinder aus deren menschlichen Gestalten in eine Metamorphose, in eine andere Welt. Auch ist Ismene nicht die sanftmütige Schwester der taffen Antigone, sondern steigt willig über die schwesterliche Leiche, um die Krone an sich zu reißen. Und die Selbstkasteiung Ödipus‘ nach der eigenen Selbsterkenntnis wird in schmerzhaften Einzelheiten paraphrasiert.
Das Mythische der Gegenwart – ein zeitlicher Transfer
Mit den Worten »Würdest mit deinen Fangfragen die Mauern berennen, die mein Denken errichtet. Dir Maulwurfsgänge graben durch das Fundament all meiner Überzeugungen. Durch das Dach meines festgefügten Bildes der Welt einbrechen mit dem Keil deiner Unterscheidung: wahrhaft und scheinbar. Urbild und Trugbild.«, lockt der zum Leben erwachte Satyr Marsyas den stummen, zum Tode verurteilten Sokrates zu einem philosophischen Wettstreit über regulierte Normen und philosophische Erkenntnisse. Erkenntnisse, die auch Werle offenlegt, indem er die Wahrhaftigkeit mythischer Urbilder und den mythischen Schein der Gegenwart dramatisiert.
Zeit spielt bei Werle eine elementare Rolle. Nicht nur tritt er als Autor in Kommunikation mit der Historie, vielmehr erinnert sein Stücke-Kanon an eine Zeitmaschine, die neben der Antike auch durch die Imitation von Shakespears Poetik in Clown- und Totengräberszenen das elisabethanische Weltbild streift, um anschließend durch die versteckte Kritik an heutigen Imperialisten im Stück »Melos. Die Invasion der Insel« wieder in der Gegenwart anzukommen.
Ohne erzwungene Neuinterpretation
Dabei sind die Stücke keine massiven Tragödien, der Dualismus des apollinischen und dionysischen Prinzips (Nietzsche) findet sich im intimen Dialog wieder. Werle verarbeitet Kernelemente antiker Tragödien wie das Schicksal, die Metamorphose und sprachliche Elemente wie den Botenbericht und verzichtet auf Chorszenen. Er vertraut auf die Wirkkraft, auf die Grausamkeit der Sprache und schafft einen gelungenen Ausgleich zwischen tragischer Aufladung und clownesker Entladung. Wodurch dem Dramatiker eine subtile Dichtung des 21. Jahrhunderts gelungen ist, ohne den Tyrannen SS-Uniformen anzuziehen, oder die rebellischen Jugend im Hip-Hop-Slang sprechen lassen zu müssen.
