 Leif Randt veröffentlichte im August 2011 seinen zweiten Roman »Schimmernder Dunst über CobyCounty«, für den er im Juni mit dem Düsseldorfer Literaturpreis 2012 ausgezeichnet wird. Der Roman erzählt von einer Stadt am Meer, in der für Bewohner und Touristen ein sorgenfreies Leben möglich scheint. Es handele sich um einen »epochalen Generationenroman« schrieb die FAZ über diese milde Utopie, unter deren Oberfläche der Schrecken lauert.
Leif Randt veröffentlichte im August 2011 seinen zweiten Roman »Schimmernder Dunst über CobyCounty«, für den er im Juni mit dem Düsseldorfer Literaturpreis 2012 ausgezeichnet wird. Der Roman erzählt von einer Stadt am Meer, in der für Bewohner und Touristen ein sorgenfreies Leben möglich scheint. Es handele sich um einen »epochalen Generationenroman« schrieb die FAZ über diese milde Utopie, unter deren Oberfläche der Schrecken lauert.
Der Autor im Interview über Gymnasiallehrer, Rapmusik und erhabene Traurigkeit.
Lieber Leif Randt, fahren Sie gerne mit der Mitfahrgelegenheit?
Ich bin Zugfahrer. Meine letzte Mitfahrgelegenheit habe ich 2005 genommen. Ich habe diese Fahrt aber noch in guter Erinnerung. Es saßen vier junge Männer zusammen in einem Nissan. Drei Hessen und ein Südamerikaner. Es war Sommer. Wir sprachen von Grillpartys und Vietnamreisen.
Ihre Kurzgeschichte »Spätsommer 2010« spielt in einem Auto und auf einer Raststätte. Es passiert nicht viel, doch fühlt man sich nach dem Lesen seltsam leer und stumpf. Wie entgeht man der Falle, ein Misanthrop zu werden?
Durch Sport und guten Tee. Früher hatte ich öfter misanthropische Phasen. Heute kommt es mir so vor, als würde meine Herzlichkeit mit jeder Woche wachsen. Vor ein paar Tagen suchte ich nach einer Lesung gezielt das Gespräch mit jemandem aus dem Publikum, der meinen Text und meine Art darüber zu reden, deutlich kritisiert hatte. Ich hatte ihn vom Podium aus noch geschnitten. Später wollte ich das angetrunken versöhnen. Der Typ war Germanist und Gymnasiallehrer. Er sagte: »Wenn ich abends Rilkes Prosaminiaturen lese, brauche ich kein Bier.«
Ha – mein Deutschlehrer war ebenfalls Rilke-Enthusiast. Trauriger Charakter, so ca. »Der Panther«. Warum war dieser Lehrer bei Ihrer Lesung? Um zu prüfen, ob »Schimmernder Dunst über CobyCounty« das Zeug zur Schullektüre hat? Würden Sie das überhaupt zulassen?
Ich fände CobyCounty als Schullektüre fantastisch. Das könnte mal so ein leicht staubiger und kaum nachvollziehbarer Text aus einer alten Zeit werden.
In Ihren Geschichten erliegen die Protagonisten einem inneren Zwang der permanenten Selbstreflektion. In Ihrem Debüt-Roman »Leuchtspielhaus« ist es Eric, in »Schimmernder Dunst über CobyCounty« Wim. Was ist das Verführerische an stetiger Selbstkontrolle?
Ich glaube, man kann sich das nur bedingt aussuchen. Wenn man reflektieren kann, sollte man das tun. Es muss ja nichts Verbissenes haben. Man darf sich nur nicht zu viel Input in Form von Meinungstexten zuführen. Ich lese in den letzten Monaten etwas mehr Zeitung. Ich glaube, das bekommt mir nicht.
Ihre Hauptfiguren lachen selten. Ist das Lachen etwa ein Zeichen mangelnder Selbstkontrolle und vielleicht sogar ordinär?
Das ist ein guter Hinweis. Eric und Wim lachen beide selten. Aber Eric ist ja auch eher eine schüchterne Kamera als ein echter Junge. Wim verfügt über eine erhabene Traurigkeit, da wäre Gelächter unpassend. Ich denke, dass in meinem nächsten Buch mehr gelacht werden wird. Ich lache selbst auch gar nicht so selten, wie manche unterstellen … das waren schon immer Leute, mit denen ich nichts anfangen konnte, Leute, die zu mir kamen und fragten: »Lächelst du denn auch mal?« Übergriffige, unangenehme Menschen, die sich außerdem irren.
Haben Krankheit und Tod Platz in einer Stadt wie CobyCounty? Oder werden sie bloß verschwiegen?
Es gibt im Buch einen Satz über Beerdigungen: »Wenn ein Bewohner von CobyCounty stirbt, gibt es meistens ein Fest, auf dem zuerst geweint und später frenetisch getanzt wird. Aber wenn man verlassen wird, gibt es nur gewöhnliche Strandpartys (…)« Das ist Seite 69. Krankheiten gibt es nicht so viele, weil die Leute sich bewusst ernähren und Freude am Sport haben. Allerdings trinken sie viel und nehmen Drogen. Aber das Trinken und Drogennehmen passt zu ihrem Lebensgefühl, es lockert sie auf und führt psychologisch zu einer Befreiung. Das Positive überwiegt, deshalb schadet es ihnen nicht.
Thomas Bernhard schreibt in seinem Buch »Der Untergeher«: »Lange vorausberechneter Selbstmord, dachte ich, kein spontaner Akt von Verzweiflung.« Wäre das etwas für Wim?
Wenn er sich umbringen wollen würde, dann ja. Das wäre auch eine Formulierung für ihn. Aber Wim will sich nicht umbringen. Auf gar keinen Fall. Er mag schwermütig sein, aber er ist nicht depressiv.
Der Schriftsteller Jan Brandt erklärte uns, »dass sich dort, wo immer Menschen sind, Abgründe auftun.« Sind die Abgründe in CobyCounty tief?
Ich schätze, dass sie weniger tief sind als die in Frankfurt am Main. In CobyCounty sind sie teils mit feinem Sand zugeschüttet. Jan Brandt äußert viele präzise Sätze über sein Buch und das Erzählen. Einen wollte ich neulich zitieren: »Bücher, die mir die Welt erklären wollen, sind keine Literatur, sondern Propaganda.« Kurz darauf dachte ich dann aber, dass ich selbst jetzt auch in eine propagandistischere Richtung gehen könnte.
Wie könnte diese propagandistische Richtung aussehen? Können sich Schriftsteller nach dem »Fall Christian Kracht« so etwas überhaupt noch trauen?
Eines Tages möchte ich einen Ratgeber über die Liebe schreiben. Voller klarer Anweisungen, wie man zu lieben hat. Die Geste wäre: Folgt mir und lernt das Glück.
CobyCounty ist ein Ort, den der Leser zu kennen glaubt. Doch bei aller Vertrautheit erscheint er ihm auch irreal und fremd. CobyCounty ist frei von Konflikten und Katastrophen – ist es ein utopischer Ort, oder kann es ihn wirklich geben?
Vielleicht nicht in dieser Größe. Aber einzelne Straßenzüge oder Viertel können vorübergehend so sein. Oder auch ganze Lebensphasen. Ich glaube, viele Menschen erleben CobyCounty-Jahre.
Slavoj Žižek schreibt, dass der Kapitalismus einen wahrhaft utopischen Kern habe, der in der Idee besteht, dass sich die negativen Seiten der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, zum Beispiel Ausbeutung, Armut und Hunger, in Zukunft beheben lassen. Ist CobyCounty die literarisierte Version dieses utopischen Kerns des Kapitalismus und erscheint es uns vielleicht deshalb so vertraut und fremd gleichermaßen?
Das klingt gut und stimmig. Ich würde eigentlich »Ja!« dazu sagen, habe aber trotzdem das Gefühl, dass Wim der Sache nicht zu Hundertprozent traut. Er ist CobyCounty-zentristisch erzogen worden, trotzdem ahnt er, dass es auf der Welt auch anderes geben könnte. Da glimmt ein Unbehagen in ihm, deshalb muss er sie sich sein Leben immer wieder erklären. Er hat ein latent schlechtes Gewissen. Dabei bräuchte Wim das gar nicht zu haben. CobyCounty schont die Ressourcen und beutet niemanden aus.
Das Cover des in den Feuilletons des Landes bejubelten Albums »DMD KIU LIDT« von Ja, Panik ist ein Spiegel, ähnlich dem, der »Schimmernder Dunst über CobyCounty“ ziert. Ist es die Aufforderung an den Leser, sich in Ihrem Buch selbst zu spiegeln?
Wahrscheinlich ist das die Aufforderung, aber das kann man ja nicht von allen verlangen. So schön das Cover ist, inhaltlich ist es eine halbe Bevormundung. Für viele ist CobyCounty ja nur fremd. Die können sich dann auch nicht spiegeln und auch nicht so viel Spaß an dem Buch finden. Sie verstehen es nicht. Und ich verstehe diese Leser nicht. Und dann sitzt man sich gegenüber und versteht sich nicht.
 Neulich, bei einer Lesung von Christian Kracht, war ich kurzzeitig davon überzeugt, dass die Rezeption von Literatur abhängig von ihrer Inszenierung ist. Der Zauber kann verfliegen, wenn der Autor vor Publikum aus seinen eigenen Büchern liest. Haben Sie Erwartungshaltungen an sich selbst, wenn Sie vor Publikum lesen?
Neulich, bei einer Lesung von Christian Kracht, war ich kurzzeitig davon überzeugt, dass die Rezeption von Literatur abhängig von ihrer Inszenierung ist. Der Zauber kann verfliegen, wenn der Autor vor Publikum aus seinen eigenen Büchern liest. Haben Sie Erwartungshaltungen an sich selbst, wenn Sie vor Publikum lesen?
Ich mag Lesungen gern. Sie dürfen nur nicht zu lang sein. Ich versuche, mir selbst dabei zuzuhören. Manchmal fallen mir dann beim Vorlesen neue Sachen auf, die ich schlimm finde oder lustig. Die eigene Vorlesestimmung überträgt sich auf das Publikum. Man kann das nicht wirklich planen.
Während einer Lesung in Frankfurt sprachen Sie kürzlich über Popmusik und dass diese in der Hauptsache von »broken hearts« handelt. Kann man der Popmusik überdrüssig werden?
In meinem Text »Von der Flüssigkeit Magnon« habe ich geschrieben: »Im Licht der Straßenlaternen stapelt sich frisches Herbstlaub, und das Radio spielt aktuelle Popmusik, in der es um Liebe oder gebrochene Herzen geht, aber niemals um Aufbruch. Radio-Popmusik ist ein Musikstil, mit dem Jerome wohl niemals etwas anfangen konnte, der ihn nie interessierte, den er vielleicht auch nie wirklich kennengelernt hat.« Jerome hat immer nur Rapmusik gehört, die »die glaubhaft von dem Aufbruch in ein besseres Leben erzählt«. Ich kann ihn gut verstehen, aber ich halte es selbst nicht so wie Jerome. Beim Autofahren trommle ich zum Hit-Radio auf dem Lenkrad rum.
Leif Randt wurde 1983 in Frankfurt am Main geboren. Er ist freier Schriftsteller und lebt in Maintal und Berlin. Für seinen zweiten Roman »Schimmernder Dunst über CobyCounty« wurde er unter anderem mit dem Düsseldorfer Literaturpreis 2012 ausgezeichnet.

 Allzumenschlichen. Mit geradezu biblischer Schwere führt der Erzähler von Analogie zu Analogie und entwirft ontologische Fragen, deren Offensichtlichkeit im Laufe der Novelle schon bald aufdringlich wird.
Allzumenschlichen. Mit geradezu biblischer Schwere führt der Erzähler von Analogie zu Analogie und entwirft ontologische Fragen, deren Offensichtlichkeit im Laufe der Novelle schon bald aufdringlich wird.

 Ein Debütroman ist immer etwas Besonderes, oft blitzt hier am meisten das literarische Genie des Autors hervor und zeigt auf, in welche Richtungen es sich entfalten kann.
Ein Debütroman ist immer etwas Besonderes, oft blitzt hier am meisten das literarische Genie des Autors hervor und zeigt auf, in welche Richtungen es sich entfalten kann.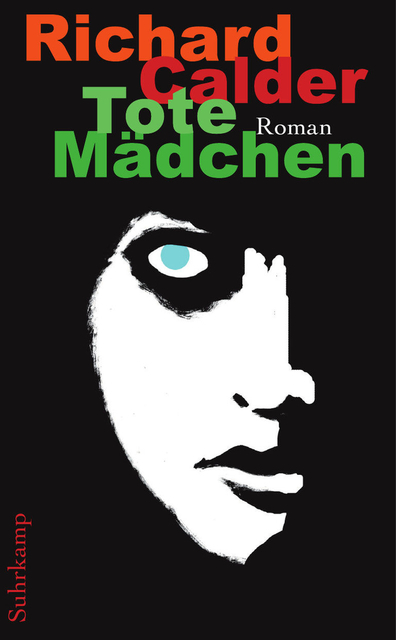 Großbritannien im Jahr 2071: In London grassiert ein Nano-Virus, der unschuldige junge Mädchen in vampireske Cyborgs verwandelt, so genannte »Puppen«, deren Reizen die Männer reihum verfallen. »Puppen-Junkies« lautet die abfällige Bezeichnung für jene »Verräter an der Rasse«, die sich mit den »toten Mädchen« einlassen und den Virus dadurch weiter verbreiten. Aus Angst um den Fortbestand der Spezies Mensch formiert sich eine fanatische »Reinheitsfront«, die schon bald von der unter Zwang angewandten »medizinischen Behandlung« der »toten Mädchen« zum eiskalt geplanten und ausgeführten Mord übergeht. Doch es regt sich Widerstand, denn die »Puppen« wollen sich dem grausamen Schicksal, dass die Menschen ihnen zugedacht haben, nicht kampflos ergeben, zumal ihre Verwandlung sie mit enormen Kräften und übermenschlichen Fähigkeiten ausstattet. Eine hungrige Vagina dentata ist da noch die geringste Gefahr für die vornehmlich männliche Menschenwelt.
Großbritannien im Jahr 2071: In London grassiert ein Nano-Virus, der unschuldige junge Mädchen in vampireske Cyborgs verwandelt, so genannte »Puppen«, deren Reizen die Männer reihum verfallen. »Puppen-Junkies« lautet die abfällige Bezeichnung für jene »Verräter an der Rasse«, die sich mit den »toten Mädchen« einlassen und den Virus dadurch weiter verbreiten. Aus Angst um den Fortbestand der Spezies Mensch formiert sich eine fanatische »Reinheitsfront«, die schon bald von der unter Zwang angewandten »medizinischen Behandlung« der »toten Mädchen« zum eiskalt geplanten und ausgeführten Mord übergeht. Doch es regt sich Widerstand, denn die »Puppen« wollen sich dem grausamen Schicksal, dass die Menschen ihnen zugedacht haben, nicht kampflos ergeben, zumal ihre Verwandlung sie mit enormen Kräften und übermenschlichen Fähigkeiten ausstattet. Eine hungrige Vagina dentata ist da noch die geringste Gefahr für die vornehmlich männliche Menschenwelt. 


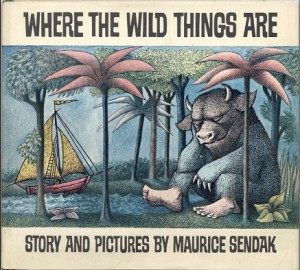


 In den letzten Jahren ist der Literaturwissenschaftler Terry Eagleton einem größeren Publikum im deutschsprachigen Raum vor allem durch zwei Bücher bekannt geworden: »Der Sinn des Lebens« von 2008 und »Das Böse« von 2011. In beiden Büchern stellt Eagleton genuin philosophische Fragestellungen und Problemlagen mit der ihm eigenen Leichtigkeit und Verständlichkeit dar und bringt sie so auch dem interessierten Laien näher. Sein jüngstes Werk mit dem Titel »Warum Marx recht hat« setzt diesen Weg fort, handelt es sich doch um eine ebenso fundierte wie streitbare Einführung in die Theorie von Karl Marx und den Marxismus. Ein schwieriges Unterfangen, zweifellos, denn über kaum jemand ist soviel gesagt und geschrieben worden wie über Marx – was natürlich den Grund darin hat, dass kaum jemand das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert so stark geprägt hat wie Marx. Vor allem aber sind über kaum einen Philosophen und dessen Theorie derart viele Unwahrheiten, Halbwahrheiten und Verzerrungen im Umlauf.
In den letzten Jahren ist der Literaturwissenschaftler Terry Eagleton einem größeren Publikum im deutschsprachigen Raum vor allem durch zwei Bücher bekannt geworden: »Der Sinn des Lebens« von 2008 und »Das Böse« von 2011. In beiden Büchern stellt Eagleton genuin philosophische Fragestellungen und Problemlagen mit der ihm eigenen Leichtigkeit und Verständlichkeit dar und bringt sie so auch dem interessierten Laien näher. Sein jüngstes Werk mit dem Titel »Warum Marx recht hat« setzt diesen Weg fort, handelt es sich doch um eine ebenso fundierte wie streitbare Einführung in die Theorie von Karl Marx und den Marxismus. Ein schwieriges Unterfangen, zweifellos, denn über kaum jemand ist soviel gesagt und geschrieben worden wie über Marx – was natürlich den Grund darin hat, dass kaum jemand das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert so stark geprägt hat wie Marx. Vor allem aber sind über kaum einen Philosophen und dessen Theorie derart viele Unwahrheiten, Halbwahrheiten und Verzerrungen im Umlauf. 

 Dietmar Dath, Schriftsteller und Journalist, und Barbara Kirchner, Professorin für theoretische Chemie, haben ein Buch geschrieben mit dem sperrigen Titel »Der Implex. Sozialer Fortschritt: Geschichte und Idee«. Doch ist der Titel allein, verglichen mit dem, was die Lektüre dieses buchgewordenen Ungetüms dem geneigten Leser abverlangt, noch vergleichsweise harmlos, denn auf gut 800 Seiten gehen Dath und Kirchner der Frage nach, »ob und wie so etwas wie sozialer Fortschritt gedacht und, wichtiger, gemacht werden kann«. Dazu durchforsten sie die Tiefen und Untiefen von Wissenschaft und Philosophie, Kunst und Literatur und picken sich heraus, was ihnen gelegen kommt und was gerade passt. Das Resultat ist ein Buch, das in seiner Komplexität und Vielschichtigkeit kaum zu fassen ist, so vollgepackt mit Informationen, Reflexionen und Ideen ist es.
Dietmar Dath, Schriftsteller und Journalist, und Barbara Kirchner, Professorin für theoretische Chemie, haben ein Buch geschrieben mit dem sperrigen Titel »Der Implex. Sozialer Fortschritt: Geschichte und Idee«. Doch ist der Titel allein, verglichen mit dem, was die Lektüre dieses buchgewordenen Ungetüms dem geneigten Leser abverlangt, noch vergleichsweise harmlos, denn auf gut 800 Seiten gehen Dath und Kirchner der Frage nach, »ob und wie so etwas wie sozialer Fortschritt gedacht und, wichtiger, gemacht werden kann«. Dazu durchforsten sie die Tiefen und Untiefen von Wissenschaft und Philosophie, Kunst und Literatur und picken sich heraus, was ihnen gelegen kommt und was gerade passt. Das Resultat ist ein Buch, das in seiner Komplexität und Vielschichtigkeit kaum zu fassen ist, so vollgepackt mit Informationen, Reflexionen und Ideen ist es. 



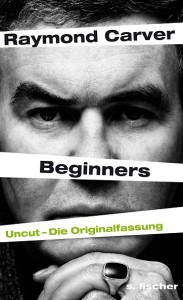


 An die Arbeitsweise des Journalisten richten sich besondere Ansprüche. So hat sich ein Journalist natürlich an die Fakten zu halten, klar, aber Fakten können auch der Literatur als Grundlage dienen. Wo ist also der Unterschied? Vielleicht liegt der Unterschied darin, dass Literatur nicht »wahr« sein muss, während ein journalistischer Text sehr wohl einer »Wahrheit« verpflichtet ist, um es pathetisch zu sagen. Aber was heißt das, einer »Wahrheit« verpflichtet zu sein? Worin besteht diese »Wahrheit« des Journalismus? Das ist keine rhetorische Frage, im Gegenteil. Zweifellos ist es eine grundlegende Frage, aber darum ist sie nicht weniger komplex. Was macht also einen gelungenen journalistischen Beitrag, einen »wahren« Beitrag aus? Zumindest im deutschsprachigen Raum wird diese Frage oft mit dem seltsamen Wort »Objektivität« beantwortet. Dagegen ist zweierlei einzuwenden: Erstens, dass es diese Objektivität, außer vielleicht als Ideal, nicht gibt und nicht geben kann. Man kann sich einem Sachverhalt von unterschiedlichen Seiten nähern, man kann verschiedene Zugänge einander entgegen halten und abwägen, aber das ist nicht objektiv, sondern allenfalls intersubjektiv, und auch dies nur in einem beschränkten Maße. Und zweitens, dass der Anspruch auf Objektivität leider mitunter dazu führt, dass journalistischen Texte eine Nüchternheit, ja man möchte sagen: eine Langeweile und eine Ödnis an den Tag legen, weil sie der irrigen Annahme folgen, dass der Verzicht auf rhetorische Mittel und sprachliche Finessen einen Text automatisch objektiv mache – nach dem Motto: nichts wagen, auch nicht sprachlich, und bloß nicht »ich« sagen.
An die Arbeitsweise des Journalisten richten sich besondere Ansprüche. So hat sich ein Journalist natürlich an die Fakten zu halten, klar, aber Fakten können auch der Literatur als Grundlage dienen. Wo ist also der Unterschied? Vielleicht liegt der Unterschied darin, dass Literatur nicht »wahr« sein muss, während ein journalistischer Text sehr wohl einer »Wahrheit« verpflichtet ist, um es pathetisch zu sagen. Aber was heißt das, einer »Wahrheit« verpflichtet zu sein? Worin besteht diese »Wahrheit« des Journalismus? Das ist keine rhetorische Frage, im Gegenteil. Zweifellos ist es eine grundlegende Frage, aber darum ist sie nicht weniger komplex. Was macht also einen gelungenen journalistischen Beitrag, einen »wahren« Beitrag aus? Zumindest im deutschsprachigen Raum wird diese Frage oft mit dem seltsamen Wort »Objektivität« beantwortet. Dagegen ist zweierlei einzuwenden: Erstens, dass es diese Objektivität, außer vielleicht als Ideal, nicht gibt und nicht geben kann. Man kann sich einem Sachverhalt von unterschiedlichen Seiten nähern, man kann verschiedene Zugänge einander entgegen halten und abwägen, aber das ist nicht objektiv, sondern allenfalls intersubjektiv, und auch dies nur in einem beschränkten Maße. Und zweitens, dass der Anspruch auf Objektivität leider mitunter dazu führt, dass journalistischen Texte eine Nüchternheit, ja man möchte sagen: eine Langeweile und eine Ödnis an den Tag legen, weil sie der irrigen Annahme folgen, dass der Verzicht auf rhetorische Mittel und sprachliche Finessen einen Text automatisch objektiv mache – nach dem Motto: nichts wagen, auch nicht sprachlich, und bloß nicht »ich« sagen.